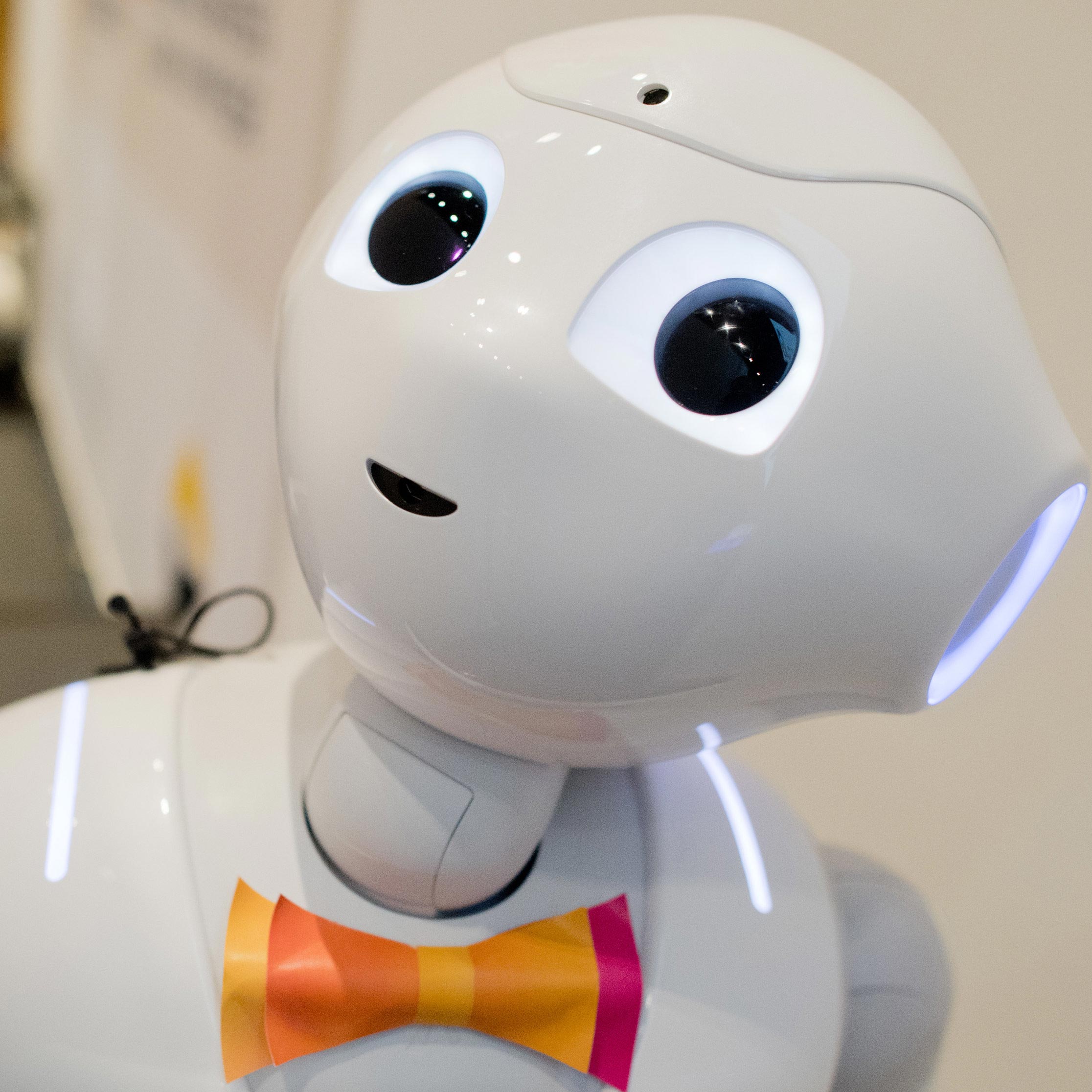Artikel Kopfzeile:
Die Kunst der guten Idee
Was ist Kreativität?
Kreativität ist mehr, als ein Bild zu malen oder ein Lied zu schreiben. Kreativität brauchen wir jeden Tag. Immer. Und sie lässt sich sogar ein bisschen trainieren.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Was ist Kreativität?
Was ist Kreativität?
Das klingt einfach, hat aber viele Facetten. Das “Neue” kann alles Mögliche bedeuten, von einem Gedanken bis hin zu einem komplexen Musikstück. Um das Ganze ein wenig greifbarer zu machen, unterscheiden Wissenschaft und Psychologie oft zwischen zwei Arten:
“Big-C”-Kreativität (manchmal auch artistische Kreativität genannt) beschreibt das, was wir etwa bei Künstlern und Künstlerinnen sehen. Professionelle Auftritte, die verändern, wie Menschen fühlen, denken oder leben. Für eine solche Kreativität benötigen wir ein besonderes Talent und Fachkenntnis. Dazu müssen wir extrem engagiert sein und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit lieben. Ein Musiker, der in einer Garage für sich alleine spielt, mag genauso viel Talent haben wie Freddie Mercury. Solange nur die Freund:innen und Familie in den Genuss kommen, sprechen wir dennoch nicht von “Big-C”-Kreativität.
Die zweite Art ist das “Little-c”: Etwas, das wir alle besitzen. Kreativität im Alltag, die es uns erlaubt, Probleme zu lösen, neue Rezepte auszuprobieren, Witze auszudenken. Dazu gehört die Garagenmusik. Genauso aber auch die Frage: “Mein Auto muss in die Werkstatt. Wie komme ich von dort wieder nach Hause?”
Keine klare Trennlinie
Manchmal ist der Übergang von Little-c zu Big-C fließend: Wie groß muss das Publikum oder der Einfluss auf das Leben anderer sein, damit es als Big-C Kreativität gilt? Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, findet den Unterschied nicht so bedeutsam: “Das ist ein Ausdruck dessen, wie die Leistung bei anderen ankommt. Was psychologisch für den oder die Einzelne dahintersteckt, ist aber vergleichbar.”
Kreativität braucht einen Nutzen
Wichtig sei das “Schaffen”: Am Ende muss etwas Nützliches herauskommen. Auch hier stellt sich die Frage, was wir unter “nützlich” verstehen. Ein Bild ist nützlich, wenn es den Betrachtenden erfreut oder eine Diskussion startet. Ein Gedanke ist nützlich, wenn er mich von der Werkstatt nach Hause bringt. Haben wir aber unglaublich viele Einfälle, von denen wir nie einen umsetzen, zählt das nicht als Kreativität.
Artikel Abschnitt: Welche Fähigkeiten brauche ich für Kreativität?
Welche Fähigkeiten brauche ich für Kreativität?
Zwei Arten des Denkens
Es ist unbedingt notwendig für Kreativität. Je weiter sich die Einfälle von der Norm wegbewegen, desto kreativer werden sie: Ich könnte natürlich auch nach Hause hüpfen. Warum nicht? Es wäre zumindest durchführbar. Fliegen kommt wohl eher nicht infrage, weder mit dem Flugzeug noch mit meinen nicht vorhandenen Flügeln.
Das führt uns zum zweiten wichtigen Aspekt: dem konvergenten Denken. Aus allen Möglichkeiten müssen wir die eine heraussuchen, die uns weiterbringt. Wir schließen Verschiedenes aus und entscheiden uns letztendlich: Es ist schönes Wetter und nicht allzu weit, also laufe ich.
Um wirklich kreativ zu sein, brauchen wir sowohl die Fähigkeit zum divergenten als auch zum konvergenten Denken. Sonst hätten wir vielleicht viele Ideen, würden letztendlich aber nichts davon umsetzen.
Und wie erforscht man so was?
Ein kleiner Ausflug in die Forschungsweise: Divergentes Denken untersuchen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen häufig mit der “Alternative Uses Task”. Dabei sollen sich die Testpersonen neue Verwendungsmöglichkeiten für Alltagsgegenstände ausdenken. Wie viele Ideen sie finden oder wie weit diese vom eigentlichen Nutzen des Gegenstands entfernt sind, ist der Maßstab für ihre Kreativität.
Für das konvergente Denken gibt es den “Remote Associates Test”: Die Wissenschaftler:innen geben Wörter vor, die erst mal nichts miteinander zu tun haben, zum Beispiel Sauce, Pferde, Baum. Die Testpersonen sollen dann ein Wort finden, das mit all diesen Wörtern ein zusammengesetztes Wort bildet: Apfelsauce, Pferdeapfel, Apfelbaum.
Ob allerdings diese Versuche das divergente und konvergente Denken wirklich trennen können, bezweifeln manche. In einer Publikation von 2019 argumentieren amerikanische Forschende, dass für beide Aufgaben divergentes und konvergentes Denken nötig sind.
Intelligenz hilft bei der Kreativität
Neben der Denkfähigkeit gibt es persönliche Eigenschaften, die kreative Menschen auszeichnen. Zum Beispiel die Intelligenz, sagt Hans-Peter Erb: “Wer umständlich denkt und wenig Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, ist typischerweise weniger kreativ.” Daher sei eine gewisse Intelligenz notwendig.
Die Motivation, etwas zu tun, komme außerdem bei kreativen Menschen eher von innen heraus – sie handeln, weil sie es möchten und es ihnen Spaß macht. In der Schule etwa lernen manche Schüler:innen von sich aus gerne, andere müssen durch die Noten oder die Aussicht auf einen Abschluss motiviert werden.
Wichtig findet Hans-Peter Erb außerdem, dass Kreative oft gut mit Unsicherheiten umgehen können. Gibt es ein Problem, eine Mehrdeutigkeit, einen Widerspruch? Super, immer her damit! Kreative Menschen sehen es als Herausforderung, während andere das Problem lieber gar nicht erst bemerken. Man nennt diese Fähigkeit Ambiguitätstoleranz. Sie zählt ebenso wie die Neugier und Offenheit für das Neue zu den Eigenschaften, die wir bei kreativen Menschen häufig finden. Über kreative Eigenschaften und andere Fragen rund um die Kreativität spricht Hans-Peter Erb übrigens auch in seinem Videoblog.
Artikel Abschnitt: Können wir kreatives Denken aktiv steuern?
Können wir kreatives Denken aktiv steuern?
Vermutlich brauchen wir also eine Mischung aus aktiver Steuerung und passivem Zulassen, schreibt der amerikanische Psychologe Roger E. Beaty in einer Veröffentlichung von Anfang 2020.
Kreativität wächst auch aus Erfahrungen
Für die aktive Einschätzung unserer Ideen brauchen wir das Wissensgedächtnis (semantisches Gedächtnis). Immerhin müssen wir erkennen, was realistisch ist und was nicht. Das Wissen über die Welt bietet der Kreativität eine Art Gerüst. Wer auch immer Schokobrötchen erfunden hat, wusste: Menschen lieben Schokolade und essen gerne Brötchen – warum nicht beides zusammen?
Wie sehr bei der Kreativität die exekutiven Funktionen, also das kontrollierte Denken, benötigt werden, diskutieren Wissenschaftler:innen noch. Verschiedene Theorien gehen, wie auch Roger Beaty, von einem Mix von kontrollierten und freien Gedanken aus. Wie viel gesteuertes Denken gut für die kreative Entfaltung ist, lässt sich allerdings bisher nicht sagen.
Artikel Abschnitt: Wie entsteht Kreativität im Gehirn?
Wie entsteht Kreativität im Gehirn?
Um die Ideen dann zu bewerten, brauchen wir ebenfalls den Hippocampus und verschiedene Regionen des DMN. Zusätzlich werden aber noch Gehirnregionen mit Kontrollfunktionen aktiv. Das ist deshalb besonders spannend, weil das spontane DMN und die wohlüberlegten Beurteilungen durch die Kontrollregionen normalerweise nicht gleichzeitig agieren. Bei kreativen Menschen scheinen diese komplementären Vorgängen vermehrt miteinander zu kommunizieren, wie Studien mit funktionaler Magnetresonanztomografie (fMRT) nahelegen.
Männer und Frauen sind anders kreativ
Zudem gibt es offenbar bei der Kreativität Unterschiede zwischen Frauen und Männern. 2014 veröffentlichten Wissenschaftlerinnen der Universität Gießen eine Studie, in der sie den Einfluss des Geschlechts auf Kreativität beschrieben. Dabei zeigten sie beispielsweise, dass Männer bei divergentem Denken (Ideenbildung) eher auf Erinnerungen an frühere Erfahrungen und faktisches Wissen zurückgreifen. Bei Frauen waren hingegen Gehirnregionen besonders aktiv, mit denen sie sich in andere Personen hineinversetzen oder Informationen auf sich selbst übertragen konnten. Es sieht also so aus, als würden Männer und Frauen unterschiedliche Prozesse nutzen, um kreative Ideen zu bilden.
Nicht alles ist schon verstanden
Wie genau Kreativität im Gehirn entsteht und welche Botenstoffe daran beteiligt sind, ist noch nicht klar. Ein Hormon, das Oxytocin, scheint jedoch eine Rolle zu spielen. Bekannt ist es als das Kuschelhormon, weil es etwa bei Muttergefühlen und bei der Nähe zu anderen Menschen wichtig ist und Vertrauen fördert. Es hat aber auch eine andere Seite, die wir häufig im Tierreich sehen: Nähert sich eine Gefahr dem eigenen Baby, werden die Mütter aggressiv – unter anderem dank Oxytocin. Und offenbar stärkt das Hormon auch den Wunsch nach neuen Erfahrungen und die Kreativität.
In einer Untersuchung, die 2014 veröffentlicht wurde, bekamen Testpersonen Oxytocin durch die Nase verabreicht. Es verringerte ihr analytisches Denken und regte gleichzeitig die Kreativität und das divergente Denken an. Aber auch hier gilt: Wie genau Oxytocin zu den kreativen Prozessen beiträgt, ist noch unklar.
Artikel Abschnitt: Wie lässt sich Kreativität fördern?
Wie lässt sich Kreativität fördern?
Kurzfristige Kreativitäts-Booster
In einer britischen Studie von 2020 brachten Wissenschaftler:innen ihren nicht musikalischen Versuchspersonen bei, Melodien zu erstellen. Über drei Test-Sessions entwickelten sie tatsächlich mehr Kreativität in ihrer Musik. Ob sich das auch auf andere Lebensbereiche übertragen lässt, wissen wir nicht.
Allerdings ist es durchaus möglich, das kreative Denken kurzfristig zu verbessern.
Dabei spielt das Umfeld eine wichtige Rolle, sagt Hans-Peter Erb: “Gibt es starke Normen oder Verbote, behindert das die Kreativität.” Viel Freiheit und möglichst wenig Einschränkungen schaffen also die Grundvoraussetzungen.
Stimmungsschwankungen gefällig?
Dazu kommt die Stimmung, in der wir uns befinden: Bei guter Laune sind wir kreativer. Das bezieht sich vor allem auf das divergente Denken, mehr Ideen können sich entfalten. Doch auch schlechte Stimmung ist ab und zu hilfreich, fügt Hans-Peter Erb hinzu. Das fördere das analytische, konvergente Denken. So können wir aus den vielen Ideen besser diejenigen herausfiltern, die tatsächlich nützlich sind.
Tipps für die Praxis
Eine praktische Möglichkeit, Lösungen für spezifische Probleme zu finden: Einfach mal eine Pause machen und die Gedanken schweifen lassen. Dabei kann es helfen, die Umgebung zu ändern – wer hat nicht schon einmal unter der Dusche die Lösung für ein Problem gefunden?
Alternativ könnten wir uns eine beliebige Erinnerung so detailliert wie möglich vorstellen. Auch das soll die Kreativität für eine Weile stärken.
Ob Bewegung hilft, ist noch nicht eindeutig nachgewiesen. Allerdings untersuchten Marily Oppezzo und Daniel Schwartz von der Stanford University 2019 den Einfluss von Spaziergängen in verschiedenen Testläufen. Manchmal sollten ihre Testpersonen sitzen, manchmal auf dem Laufband oder draußen laufen. Sie fanden heraus, dass die meisten Ideen durch das Laufen an der frischen Luft entstanden und dieser Effekt auch noch anhielt, wenn die Testpersonen hinterher am Schreibtisch saßen.
Die Ergebnisse passen gut zusammen mit dem Gedanken, einfach mal die Umgebung zu wechseln – und selbst, wenn der Spaziergang nicht die gewünschten Lösungen liefert, schadet die Bewegung sicher nicht.
Hilft Unordnung?
Kann ein unaufgeräumter Schreibtisch auch zur Kreativität beitragen? Diese Frage stellten sich Wissenschaftler:innen in einer Studie von 2013. Sie kamen zu dem Schluss, dass eine unordentliche Umgebung kreatives Denken fördert. Außerdem waren ihre Testpersonen eher offen für neue Erfahrungen, wenn etwas Chaos um sie herum herrschte. Allerdings führten amerikanische Forschende 2019 ein ähnliches Experiment mit mehr Testpersonen durch – und fanden keine Vorteile einer unordentlichen Umgebung für die Kreativität. Vorläufig müssen wir uns wohl auf unsere eigenen Präferenzen verlassen.
Artikel Abschnitt: Was bedeutet Kreativität für Kinder?
Was bedeutet Kreativität für Kinder?
In der Krippe und im Kindergarten sollten die Erzieherinnen und Erzieher vor allem einen Rahmen geben, in dem sich die Kinder entfalten können, sagt Bianca Kindlein. Sie leitet die Kita Kunterbunt in Erbach im Odenwald. “Die Kinder brauchen Regeln, die sie aber nicht zu sehr einschränken.” Oft beobachten die Erzieher:innen daher, was die Kinder machen, und bieten dann beispielsweise Materialien an, mit denen die Kleinen weiter experimentieren können. In der Krippe geht es dabei häufig um das Sortieren, Schöpfen oder Tragen von Gegenständen, wobei gerade die Wiederholung für die Kinder wichtig ist.
Je nach Alter unterschiedliche Förderung
Im Kindergartenalter haben die Kinder dann schon mehr Erfahrung. Sie finden Präferenzen und können mehr Materialien nutzen, sind aber bereits an Konventionen und Regeln gewöhnt und denken somit weniger frei als die Krippenkinder. Neue Ideen fördern Erzieher:innen beispielsweise, indem sie immer wieder unbekannte Gegenstände anbieten, sagt Bianca Kindlein. So wecken sie das Interesse und die Neugier. Ebenso wichtig ist der Kontakt mit Gleichaltrigen: Ideen von Freunden und Freundinnen regen zum Weiterdenken und Diskutieren an.
Erwachsene, ob in der Kita oder in der Familie, sollten vor allem Fragen stellen, so die Verhaltenstherapeutin Ariadne Sartorius. “Kinder kommen auf Ideen, die mir gar nicht eingefallen wären.” Geben die Bezugspersonen hingegen ständig Lösungen vor, lernen die Kinder das divergente Denken, also die Suche nach verschiedenen Möglichkeiten, erst gar nicht. Auch die Art der Fragen spielt eine Rolle: Bianca Kindlein rät zu offenen Fragen wie “Was hast du gemalt?” statt “Hast du einen Hund gemalt?”So können die Kinder frei erzählen, anstatt nur mit Ja oder Nein zu antworten.
Welt mit allen Sinnen erfahren
Dazu kommt, dass Kinder den Input der verschiedenen Sinnesorgane brauchen: Tasten, Riechen, Schmecken ist deutlich wichtiger als bei Erwachsenen. “Wir simulieren viele Vorgänge im Kopf”, sagt Hans-Peter Erb. “Kinder müssen die Handlungen dagegen noch konkret ausführen.”
In der Schule müssen Lehrerinnen und Lehrer zwei Ziele vereinen: Faktenwissen vermitteln und gleichzeitig das eigenständige Denken fördern. Keine einfache Aufgabe, doch es gibt ein paar Vorschläge, wie man Kreativität in das tägliche Schulleben einbauen kann. Das geht sogar in Fächern wie Mathematik, in denen wir es vielleicht weniger erwarten würden als in Kunst oder Sprachen. So könnte man statt “Was ergibt vier plus vier?” auch fragen: “Welche Rechnung ergibt acht?” Das stärkt nicht nur kreatives Denken, sondern spricht gleichzeitig noch mehr mathematische Fähigkeiten an.
Wie die Lehrerkräfte Fragen oder Aufgaben stellen, kann ebenfalls einen Einfluss haben. Tatsächlich führt die Anweisung “Sei kreativ” zu einer größeren Ideenvielfalt als etwa die Vorgabe, so viele Ideen wie möglich zu finden. Dieses Phänomen ist in der Kreativitätsforschung so verankert, dass es den Namen Sei-kreativ-Effekt (engl. be creative effect) bekommen hat.
Und es ist eine Methode, die sich problemlos in den Unterricht einbauen lässt. Es gibt also Wege, Kreativität in der Schule zu fördern und dabei das Faktenlernen nicht aus den Augen zu verlieren. Manche Lehrenden tun das bereits, andere brauchen vielleicht selbst noch mehr kreatives Denken, um es an die Schüler und Schülerinnen weiterzugeben.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift: