Artikel Kopfzeile:
Coronavirus und Pocken im Vergleich
Was wir über Corona von den Pocken lernen können
Durch konsequentes Impfen haben die Menschen die tödlichen Pocken ausgerottet. Hilft uns dieses Wissen beim Kampf gegen das Coronavirus?
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht’s:
Darum geht’s:
Die Ausrottung der Pocken ist eine Erfolgsgeschichte
Pocken werden auch Blattern oder Variola genannt. Erreger ist das Variola- oder Pockenvirus VarV (Variola virus). Dieses Virus ist hochansteckend und für den Menschen sehr gefährlich. Wie viele Todesopfer es insgesamt gab, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber allein im 20. Jahrhundert starben etwa 300 Millionen Menschen an den Pocken.
So verläuft eine Infektion mit dem Pockenvirus
Einige Tage nach der Infektion mit dem Virus treten erste Symptome wie hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen auf. Etwa 72 Stunden später erscheint der typische Ausschlag, der sich von roten Flecken über linsengroße Knötchen zu schmerzhaften, mit einer hochinfektiösen Flüssigkeit gefüllten Bläschen entwickelt. Zwei bis drei Wochen nach Ausbruch der Erkrankung verschorfen die Bläschen. Nach dem Abfallen der Kruste bleiben die Pocken-typischen Narben zurück.
Überlebte ein Mensch eine Infektion mit dem Pockenvirus, war er ein Leben lang dagegen immun. Nur: Ein bis zwei Drittel – die Quellen sind hier nicht eindeutig – aller Infizierten starben daran.
Das Pockenvirus ist alt
So ganz klar ist nicht, ob das Pockenvirus schon bei den Alten Ägyptern auftrat. Aber in China wurde bereits im 4. Jahrhundert nachweislich eine Pockenepidemie dokumentiert. Danach gab es immer wieder Meldungen großer Epidemien und Pandemien. Wanderungsbewegungen, Kolonialisierungen und eine generell intensivere Vernetzung der Menschen durch etwa schnellere Reisemöglichkeiten brachten das Virus auch in den letzten Winkel der Erde.
In Deutschland fand die letzte schwere Pockenepidemie zwischen 1871 und 1874 statt; etwa 170.000 Menschen starben.
Die erste Pockenimpfung entstand durch Zufall
Bereits früh in der Geschichte der Pocken fiel auf, dass genesene Menschen nicht erneut an dem Virus erkrankten. Angeblich bereits um 1000 vor Christus wurden daher Menschen gezielt mit Flüssigkeit aus Pusteln an Pocken Erkrankter infiziert. Dies geschah über die Haut, was in den meisten Fällen einen leichteren Verlauf der Krankheit zu Folge hatte als bei einer Infektion durch Einatmen. Trotzdem waren diese Infektionen nur schwer kontrollierbar.
Eine Beobachtung Ende des 18. Jahrhunderts brachte den Durchbruch: Menschen, die eine Infektion mit Kuhpocken durchlebt hatten, zeigten bei einer nachfolgenden Infektion mit den Menschen-Pocken keine oder nur eine leichte Erkrankung. Der englische Landarzt Edward Jenner behandelte Menschen mit einem abgewandelten Virus, dem Vaccinia-Virus (VACV), das auf Kuh- oder Pferdepocken-Viren basiert. Damit erfand er die moderne Schutzimpfung. Das heute noch verwendete Wort Vakzin (im Englischen: vaccination) erinnert daran, denn vacca ist das lateinische Wort für Kuh. Wann und wie genau das Vaccinia-Virus entstand, ist unklar.
Eine weltweite Impfpflicht führte zur Ausrottung des Pockenvirus
Auch wenn es regional immer wieder Aufforderungen zum Impfen gab, brachte erst die weltweit eingeführte Impfpflicht den erhofften Erfolg. Außerdem gelang es, den Impfstoff in großen Mengen herauszustellen und ihn haltbar zu machen. Damit ließ er sich längerfristig lagern und auch in strukturschwache Regionen transportieren. 1967 startete die WHO die beispiellose Pocken-Ausrottungskampagne, die akribisch und konsequent umgesetzt wurde.
Einen letzten dokumentierten Pockenpatienten in Deutschland gab es 1972 in Hannover. Als weltweit letzter Fall gilt ein Ausbruch der Menschenpocken im Jahr 1977 in Somalia. Seitdem gilt die Erde als pockenfrei. Nur in zwei Labors der höchsten Biosicherheitsstufe 4 in den USA und Russland werden Pockenviren noch zu Forschungszwecken aufbewahrt.
Artikel Abschnitt: Aber:
Aber:
Coronaviren sind keine Pockenviren
In dieser Übersicht stellen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Viren gegenüber:
| Pockenvirus | Coronavirus | |
| Abkürzung | VarV (für Variola virus) | SARS-CoV-2 (für Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) |
| Erkrankung | Pocken | Covid-19
(für Coronavirus Disease 2019) |
| Erbgut auf Basis von | DNA | RNA |
| Infektionsweg | Tröpfchen, Körperflüssigkeiten, Viruspartikel-haltiger Staub, vermutlich auch Aerosole | Tröpfchen, Aerosol, eventuell Schmierinfektion |
| Inkubationszeit
(Zeit zwischen Infektion und Auftreten erster Symptome) |
12 Tage (7–19 Tage) | 6 Tage (1–14 Tage) |
| Charakteristische Symptome | Typische Pusteln | Uncharakteristisch; Verwechslungsgefahr mit anderen Erkrankungen; Geruchs- und Geschmacksstörungen |
| Auch ohne Symptome ansteckend? | Ja | Ja |
| Fallsterblichkeit
(die Wahrscheinlichkeit, als Erkrankter zu sterben) |
etwa 30–60 % | * 1–14% |
| Therapie | Keine | * Bisher keine |
| Spätfolgen | Entstellende Narben, Lähmungen, Gehörlosigkeit, Erblindung, evtl. Hirnschäden | * Nervenschädigungen, Lungenschäden |
| Immunität nach Erkrankung | Lebenslang | * ja; aber vermutlich nur wenige Jahre oder sogar Monate |
*nach bisherigem Wissensstand (28.05.2020)
Bislang sind weltweit etwa 401.000 Menschen an Covid-19 gestorben (Stand 07.06.2020). Das sind etwa 5,8 Prozent der bestätigten Infizierten und damit deutlich weniger als bei den Pocken. "Die hohe Fallsterblichkeit war der besondere Schrecken der Pocken“, sagt Prof. Hartmut Hengel. Der Virologe ist Leiter des Instituts für Virologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Präsident der Gesellschaft für Virologie. Unklar ist nach wie vor, wie viele mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen keine Symptome entwickeln und somit durchs Raster fallen. Die tatsächliche Letalitätsrate, also das Verhältnis der an Covid-19 Verstorbenen zu den Corona-Infizierten, liegt vermutlich noch deutlich niedriger.
Eine solche Dunkelziffer gab es bei den Pocken allerdings möglicherweise ja auch.
Hengel sieht aber auch Gemeinsamkeiten: "Beide Viren zeigen eine Altersabhängigkeit, das heißt, auch beim Pockenvirus waren ältere Menschen und Erwachsene mehr gefährdet als jüngere Erwachsene und Kinder."
SARS-CoV-2 ist ein recht neues Virus. Viele Eigenschaften sind noch nicht hinreichend bekannt und müssen in den kommenden Monaten und Jahren ausgiebig erforscht werden. Was wir aber wissen: In der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts hat es ein Virus wie SARS-CoV-2 deutlich einfacher, sich schnell und unkontrolliert über die gesamte Welt zu verbreiten. Auch dies gilt es bei einem Vergleich von Corona- und Pockenvirus zu berücksichtigen.
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Wir können trotzdem etwas lernen
1. Das Pockenvirus ist ein träges Virus
Genetische Untersuchungen zeigen, dass das Variola-Virus, das die Menschenpocken auslöste, sich über all die Jahrhunderte relativ wenig veränderte. "Gleichzeitig zeigte das Vaccinia-Virus, mit dem geimpft wurde, zuverlässige Kreuzreaktionen mit unterschiedlichen Pockenstämmen", sagt Virologe Hartmut Hengel. Die Impfung schlug also besonders gut und breit an.
Und SARS-CoV-2? "Für ein RNA-Virus ist es relativ stabil und mutiert nicht so häufig wie andere bekannte RNA-Viren, etwa das Influenzavirus", sagt Hengel. Der Erreger der saisonalen Grippe verändert sich so schnell, dass der Impfstoff jedes Jahr angepasst werden muss. Ein solches Virus kann durch eine Impfung nicht ausgerottet werden, zumindest nicht nach heutigem Wissensstand.
2. Das Pockenvirus kann sich nicht verstecken
Infizierte sich ein Mensch mit dem Menschen-Pockenvirus, gab es nur drei Möglichkeiten: Er erkrankte und starb; er erkrankte und überlebte; er erkrankte nicht. Genesene und symptomfreie Infizierte waren nach einer gewissen Zeit immun und steckten dann auch keine anderen Menschen mehr an.
Anders ist dies zum Beispiel bei HIV, dem Humanen Immundefizienz-Virus und Auslöser von Aids. Das HI-Virus kann sich in Zellen des menschlichen Immunsystems über Jahre verstecken, ohne dass Krankheitszeichen auftreten (latente Infektion). Auch antivirale Medikamente erreichen diese Virenreservoirs nicht. Wird eine Therapie beendet, vermehren sich die Viren wieder, der Patient kann erneut weitere Menschen anstecken.
"Nach allem was wir bisher wissen, bildet das SARS-CoV-2 keine Latenz, sondern wird endgültig entfernt, wenn der Patient die Infektion überlebt", sagt Hartmut Hengel und fügt einschränkend hinzu: "Allerdings weiß man von anderen Coronaviren, dass die spezifischen T-Gedächtniszellen und Antikörper innerhalb weniger Jahre wieder verschwinden." Das bedeutet, dass nach dieser Zeit eine Re-Infektion möglich ist. Wie genau das beim aktuellen Corona-Virus der Fall ist, wird sich erst in ein paar Jahren feststellen lassen.
3. Mensch als einziges Virus-Reservoir
Das Pockenvirus wurde nur von Mensch zu Mensch übertragen, nicht über tierische Zwischenwirte. Infektionsgeschehen konnten so gut eingegrenzt werden, wenn sich Infizierte und Kontaktpersonen konsequent in Quarantäne begaben.
SARS-CoV-2 nimmt es nicht so genau: "Das Coronavirus kann offenbar Speziesbarrieren überwinden", sagt Hengel. Infektionen von Katzen und Frettchen sind bereits bekannt. Inwieweit Tiere allerdings eine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen, ist unklar. Momentan gilt die Mensch-zu-Mensch-Übertragung als Hauptübertragungsweg. Deshalb können auch hier gezielte Quarantänemaßnahmen regionale Krankheitsausbrüche eingrenzen.
4. Pocken leicht zu erkennen
Die charakteristischen Pusteln machen eine Identifizierung einer Pocken-Infektion relativ einfach. Während der Pocken-Ausrottungskampagne der WHO erhielt Personal im Gesundheitswesen Schulungen, um Infektionen schnell und sicher zu erkennen. So ließen sich infizierte Menschen gezielt unter Quarantäne stellen. Kontaktpersonen erhielten eine Impfung. Dieses Prinzip der Ring-Impfung dämmte Infektionen effektiv ein.
Inzwischen gibt es auch genetische Methoden, um das Pockenvirus zu identifizieren. Mit dieser Methode (RT-PCR) wird heute auch das Coronavirus SARS-CoV-2 detektiert.
Ein Impfstoff muss her
Um SARS-CoV-2 auf Dauer unter Kontrolle zu bekommen, hilft nach jetzigem Wissensstand nur impfen. "Das ist das Ziel, um die Bevölkerung zu schützen und um keine permanente Viruszirkulation aufgrund von Re-Infektionen zu haben", sagt Hengel. Aber ein solcher Impfstoff müsse besser sein als das Virus selbst, ist der Virologe überzeugt: "Nur wenn der Impfstoff längerfristig immun gegen das Virus macht, lässt sich eine gute Herdenimmunität erreichen."
Noch gibt es keinen Impfstoff, aber Wissenschaftler weltweit forschen an zahlreichen unterschiedlichen Ansätzen. Dabei helfen ihnen Erfahrungen, die sie bereits mit anderen Coronaviren gesammelt haben: MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), das seit 2013 vor allem in Saudi-Arabien wütet, sowie SARS-CoV, der Erreger der SARS-Pandemie 2002/2003. Allerdings gibt es auch gegen diese Viren bisher weder Therapien noch Impfstoffe. Hengel ist zwar generell optimistisch, dass Forscher einen Impfstoff finden, aber – nach eigenen Angaben – auch realistisch: "Impfstudien sind langwierig, denn Impfstoffe müssen sehr sicher sein und sorgfältig geprüft werden. Das dauert seine Zeit." Oft Jahre.
Bis dahin: Abstand halten
Bis auf Weiteres gilt es deshalb, eine Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Dazu gibt es klare Empfehlungen:
- Hände oft und gründlich waschen
- Abstand halten
- Menschenansammlungen meiden, besonders in geschlossenen Räumen
- Husten und Niesen in Armbeuge
- Mund- und Nasenschutz tragen
- bei Infektion Quarantäne einhalten
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:


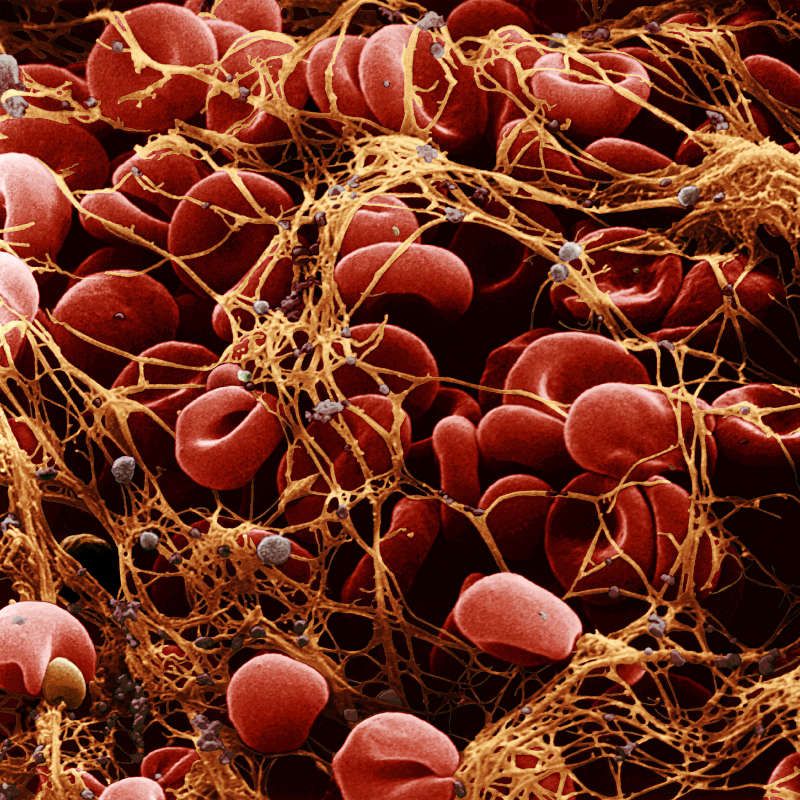



Meine Tochter wird nun gegen Pocken geimpft. Ich wusste nicht, dass durch die Impfung das Virus komplett ausgelöscht wurde. Aber wir müssen noch zu einer Beratung für Familien gehen. Mehr dazu:
https://www.moestlpsychotherapie.com/einsatzgebiete/eltern-paare–familien