Artikel Kopfzeile:
Gehirnerschütterungen
Deshalb können einige Sportarten deinem Gehirn dauerhaft
schaden
schaden
Nicht nur beim Boxen, auch beim Eishockey, American Football oder Fußball kann dein Kopf
schön was abbekommen. Jedes Schädel-Hirn-Trauma hinterlässt Spuren.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht’s:
Darum geht’s:
Bei einigen Sportarten bekommt der Kopf immer wieder heftige Stöße ab
Eishockey und American Football im Visier der Forschung
Wie schwerwiegend Schläge gegen den Kopf sein können, blieb lange Zeit relativ unerforscht. Erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten ermöglichten moderne Messmethoden detailliertere Einblicke ins Gehirn. "Was wirklich bei Gehirnerschütterungen passiert, wurde nicht nur an Boxern, sondern auch bei American-Football- und Eishockey-Spielern untersucht", sagt Hans Förstl. Denn auch hier bekommen die Athlet:innen regelmäßig durch das Zusammenprallen mit gegnerischen Spieler:innen heftige Stöße gegen den Kopf. Immer wieder liegen Spieler:innen mit einem Blackout auf dem Feld.
Nervenverbindungen leiden unter der Erschütterung
Gedächtnislücken bei Gehirnerschütterungen sind keine Seltenheit: Durch die schnelle Beschleunigung des Kopfes wird das Gehirn gegen die Schädelknochen gepresst. Schwerkräfte führen zu einer Stauchung oder Dehnung zentraler Nervenbahnen. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen kann kurzzeitig zusammenbrechen. "Axone, also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, werden beschädigt oder können ganz reißen", erklärt Hans Förstl.
Gefährliche Praxis: weiterspielen trotz Gehirnerschütterung
Oft werden die Sportler:innen trotz einer Gehirnerschütterung nach einer kurzen Pause wieder auf das Feld geschickt. Das bedeutet für die Betreffenden ein zusätzliches massives Risiko: das Second-Impact-Syndrom, also der Zweitschlag-Effekt. Dieser besagt: Wenn auf eine nicht abgeklungene Erschütterung eine weitere trifft, drohen oft bleibende Schäden. Das Gehirn kann durch innere Verletzungen sogar so stark anschwellen, dass die Situation lebensgefährlich wird.
Schädel-Hirn-Traumata können neuronale Erkrankungen auslösen
"Kaputte Verbindungen zwischen den Nervenzellen kann das Gehirn in der regenerativen Phase teilweise wieder ausbilden", erklärt Hans Förstl. Gehirnerschütterungen können allerdings auch bleibende Schäden verursachen. Am Beispiel von Boxer:innen sowie American-Football-Spieler:innen zeigen Studien bereits ein klares pathologisches Bild als Folge der Schädel-Hirn-Traumata: Auch als Boxer-Syndrom bezeichnet, leiden viele von ihnen im Alter unter einer Chronischen traumatischen Enzephalopathie (CTE).
Regelmäßige Erschütterungen begünstigen Hirnentzündungen
Alle Patient:innen dieser neurodegenerativen Erkrankung haben eines gemein: Ein bestimmtes Protein namens Tau lagert sich im Gehirn dauerhaft an den falschen Stellen ein. Dabei dient Tau eigentlich als Stützskelett für Axone. Reißen diese Nervenleitungen durch eine Stauchung oder Dehnung des Gehirns, wird das Protein an diesen Stellen vermehrt freigesetzt. In ungebundener Form verkleben die feinen Mikrostrukturen zu Klumpen und können nicht mehr abtransportiert werden. Diese Verklumpungen verhindern die Kommunikation zwischen Nervenzellen, Zellen sterben ab, die weiße Hirnsubstanz schrumpft. "Außerdem gehen wir davon aus, dass es durch die immer wiederkehrenden Verletzungen und Reparaturprozesse zu einer chronischen entzündlichen Reaktion des Gehirns kommt, die auch eine schädliche Wirkung haben kann", sagt Inga Koerte von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Gehirnerschütterungen erhöhen das Demenzrisiko
Die Folgen von Veränderungen der Gehirnstruktur durch Schädel-Hirn-Trauma können vielfältig sein. Viele Boxer:innen entwickeln bereits während ihrer aktiven Zeit zumindest leichte kognitive Störungen. "Vor allem das Neugedächtnis verschlechtert sich, also was vor Stunden oder Tagen passiert ist. Denn genau diese Hirnstrukturen sind besonders empfindlich und liegen tief im Hippocampus", erklärt Hans Förstl. Zehn bis 20 Prozent der Profiboxer:innen leiden ihr Leben lang unter anhaltenden neuropsychiatrischen Erkrankungen. Ihre motorischen Fähigkeiten lassen nach und sie haben ein erhöhtes Risiko, am Parkinson-Syndrom sowie an Alzheimer zu erkranken. Depressionen und eine gesteigerte Aggressivität sind weitere Folgeerscheinungen.
Bei American-Football-Spieler:innen wurde dieser Zusammenhang ebenfalls nachgewiesen. Forscher der University of Boston scannten dafür die Gehirne von 202 bereits verstorbenen Footballspielern. 87 Prozent der Athleten litten unter Chronischer traumatischer Enzephalopathie – rund die Hälfte von ihnen zeigte neben Stimmungsschwankungen und Verhaltensauffälligkeiten noch zu Lebzeiten klare Anzeichen einer Demenz.
Eishockey: Die Gefahr liegt in den hohen Geschwindigkeiten
Laut Angaben des Bundesinstituts für Sportwissenschaft ist auch beim Eishockey das Risiko hoch, zumindest ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zu erleiden. Nach einer Auswertung von 664 schwedischen Profispielen sind Schädigungen des Kopfes im Eishockey mit 39 Prozent sogar die häufigsten Verletzungen. Die hohe Gefahr liegt unter anderem in den Geschwindigkeiten der Spieler:innen von über 50 Stundenkilometern und Pucks, die mit 170 Stundenkilometern und mehr übers Eis fliegen. Häufen sich physische Einwirkungen auf den Kopf bei Spieler:innen, steigt die Gefahr, auch längerfristige Hirnveränderungen davonzutragen (mehr dazu im Abschnitt zu Kopfbällen bei Fußballer:innen). Zwar gibt es im Eishockey Präventionsmaßnahmen, wie die Weiterentwicklung von Protektoren, Helmen und Polstern, allerdings ist der Schutz eher begrenzt.
Mit Blick auf eine andere Verletzung wurde bereits per Anordnung gegengesteuert: Nachdem im Jahr 2023 ein Spieler im britischen Profi-Eishockey nach einem Kufenschnitt am Hals gestorben war, hat unter anderem die Deutsche Eishockey Liga (DEL), aber auch der Eishockey-Weltverband (IIHF), der auch die WM ausrichtet, das Tragen eines Halsschutzes zur Pflicht erklärt. Schnittverletzungen am Hals sind im Eishockeysport jedoch deutlich seltener als Gehirnerschütterungen.
Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:
Darum müssen wir drüber sprechen:
Selbst Kopfbälle könnten dem Gehirn langfristig schaden
"Prallt der Ball gegen den Kopf, müssen nicht gleich Nervenverbindungen reißen, doch es kommt vermutlich zu einer Dehnung des Gehirns und damit zu einer vorübergehenden Funktionseinschränkung", erklärt Inga Koerte. Die Neurowissenschaftlerin beobachtete in einer Studie mit 16 Jugendlichen, dass auch die Lernfähigkeit der 15- und 16-jährigen Proband:innen direkt nach dem Kopfballtraining im Vergleich zur Kontrollgruppe eingeschränkt war.
Fußballer:innen weisen Veränderungen im Gehirn auf
Die Münchner Forscherin hat bereits mehrere Studien veröffentlicht, die zeigen: Selbst relativ leichte wiederholte Kopferschütterungen, wie sie bei Kopfbällen im Fußball vorkommen, können neben den akuten Beeinträchtigungen das Gehirn auch langfristig verändern. Gemeinsam mit der Harvard Medical School untersuchte ihr Team zwölf Nachwuchsfußballer einer deutschen Mannschaft. Keiner von ihnen hatte je eine Gehirnerschütterung erlitten. Dennoch wiesen ihre Gehirne im Vergleich zur Kontrollgruppe von acht Schwimmern großflächige Veränderungen auf: Vor allem in jenen Arealen der weißen Substanz, die für Aufmerksamkeit, komplexe Denkvorgänge und das Gedächtnis zuständig sind. Auch die Myelinscheiden, welche die Nervenleitungen ummanteln, waren bei den Profifußballern dünner. Eine solche Verdünnung führt dazu, dass sich die Impulsweiterleitung in den Nervenbahnen verlangsamt.
Denkleistung der Sportler:innen lässt im Alter nach
In einer Folgestudie, diesmal mit ehemaligen Fußballprofis im Alter von 40 bis 65 Jahren, beobachteten Inga Koerte und ihr Team, dass auch die Hirnrinde der Ex-Fußballer dünner war im Vergleich zu einer Kontrollgruppe: Je höher die geschätzte Anzahl der Kopfbälle der jeweiligen Fußballer, desto ausgeprägter erwies sich diese Verdünnung. Gleichzeitig zeigten Fußballer mit einem hohen Kopfballaufkommen auch schlechtere Leistungen im Erinnerungsvermögen. Ähnliches beobachteten auch Wissenschaftler:innen der New Yorker Albert-Einstein-Universität. Sie untersuchten 37 Amateurfußballer, die im vorangegangenen Jahr 32–5400 Kopfbälle getätigt hatten. Das Ergebnis: Schon ab einem Pensum von 885 Kopfbällen pro Jahr zeigten sich bei den Spielern mikrostrukturelle Schäden im Gehirn. Ab 1800 Kopfbällen schnitten die Probanden schlechter in Gedächtnistests ab.
"Noch haben wir keine robuste Datenlage, die beweisen würde, dass auch das Kopfballspiel beim Fußball zu einer neurodegenerativen Erkrankung wie der Chronischen traumatischen Enzephalopathie führt", sagt Inga Koerte. Obwohl in den letzten Jahren eine Reihe an Studien veröffentlicht wurde, seien die Ergebnisse hier noch nicht eindeutig. Oft seien auch nur sehr kleine Gruppengrößen untersucht worden, fügt die Ärztin an.
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Kopfverletzungen müssen ernst genommen werden
Bei Gehirnerschütterungen werden im Normalfall mindestens zehn Tage bis zwei Wochen empfohlen, in denen Athlet:innen keinen Sport oder anderweitige Anstrengungen betreiben sollten. Abhängig von den Symptomen, darf der oder die Betroffene langsam die Belastung steigern. Neue Studien deuten allerdings darauf hin, dass das Gehirn sogar noch länger braucht, um sich wieder ganz zu stabilisieren – selbst wenn klinische Diagnoseverfahren für Gehirnerschütterungen bereits grünes Licht geben.
Gehirnerschütterungen bleiben oft unerkannt
Das Problem: Nicht immer wird eine Gehirnerschütterung auch als solche diagnostiziert, vor allem die leichte Form des Schädel-Hirn-Traumas bleibt oft unerkannt. "Die Gehirnerschütterung ist bislang eine klinische Diagnose, basierend auf Symptomen, die der Patient berichtet," sagt Inga Koerte. Diese seien jedoch unspezifisch und gäben nicht immer ein klares Bild. Selbst bei radiologischen Untersuchungen in einem Computertomografen oder im Kernspintomografen erkenne man oft nichts.
Ein Bluttest soll die Diagnose erleichtern
In Zukunft könnte es allerdings einen Bluttest als weiteres diagnostisches Instrument geben. Unter anderem spielt dabei das Protein Tau eine Rolle. Das bei den Läsionen im Gehirn frei gewordene Eiweiß geht möglicherweise vor allem bei schweren Gehirnerschütterungen über die durchlässiger gewordene Blut-Hirn-Schranke auch ins Blut über. Im Idealfall soll dieser Biomarker im Blut nicht nur das Trauma an sich bestätigen. Solche Tests könnten sogar dazu beitragen, die schwere der Verletzungen im Gehirn zu bestimmen und bei der Entscheidung helfen, wann die Athlet:innen wieder fit für den nächsten Einsatz sind.
Noch reicht die Studienlage nicht aus, um die Genauigkeit des Bluttests auf die Probe zu stellen. "Tau lässt sich im Blut zwar bestimmen, ist aber sehr unspezifisch, denn das Protein entsteht auch in Nervenzellen im gesamten Körper und nicht nur im Gehirn", sagt Koerte. Es gebe eine ganze Reihe an weiteren Biomarkern, die im Moment erforscht werden, aber noch sei kein verlässlicher Bluttest entwickelt worden, mit dem man eine Gehirnerschütterung diagnostizieren kann.
Kopfschutz beim Boxen?
Um die Athlet:innen besser zu schützen, wird beim Boxen seit Langem über Kopfschutz diskutiert. Im Olympischen Boxen wurde dieser mittlerweile wieder abgeschafft. Boxer:innen hätten dadurch eine bessere Sicht und könnten schneller in Deckung gehen, so eines der Argumente. "Es besteht auch die Gefahr, dass mit Kopfschutz radikaler zugeschlagen wird", sagt Hans Förstl. Um herauszufinden, ob die Helme die Boxer:innen tatsächlich besser schützen, hat ein internationales Forschungsteam über 59 Jahre knapp 30.000 Boxkämpfe untersucht – und kommt zu dem Ergebnis, dass bei Boxkämpfen mit Kopfschutz sogar die Anzahl von Knockouts und Abbrüchen aufgrund von Kopfverletzungen gestiegen war.
Einige Länder verbieten Kopfbälle für Kinder
Obwohl die Datenlage für Langzeitfolgen von Kopfbällen im Fußball noch nicht eindeutig ist, hat der amerikanische Fußballverband bereits andere Konsequenzen gezogen und Kopfbälle für Kinder unter elf Jahren inzwischen verboten. England, Schottland und Nordirland haben seit 2020 ähnliche Regeln für Kinder eingeführt.
Der Deutsche Fußballverband (DFB) zeigt noch keine solcher Bestrebungen. Allerdings empfiehlt er bei Kindern bis zehn Jahren, diese langsam an Kopfbälle heranzuführen, zum Beispiel mit Luftballons, und rät von Übungen mit harten Bällen ab. Dabei setzt er statt einem Verbot darauf, Kindern frühzeitig die richtige Kopfballtechnik beizubringen. Denn zentral für den Schutz des Gehirns beim Kopfball sei es, den Ball mit der Stirn zu treffen und die Hals- und Nackenmuskulatur bewusst anzuspannen, heißt es in einer Pressemitteilung des DFB.
„Die Exposition durch Kopfbälle bei jungen Athleten zu vermindern, ist vermutlich eine gute Idee“, sagt Inga Koerte. Allerdings gebe es für die gewählte Altersgrenze von elf Jahren keinen wissenschaftlichen Grund. Das zeigen Koerte und ihr Forschungsteam in einer Untersuchung von internationalen Fußballmatches mit Spieler:innen im Alter von elf bis 19 Jahren. Demnach spielen Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ohnehin kaum Kopfbälle.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:


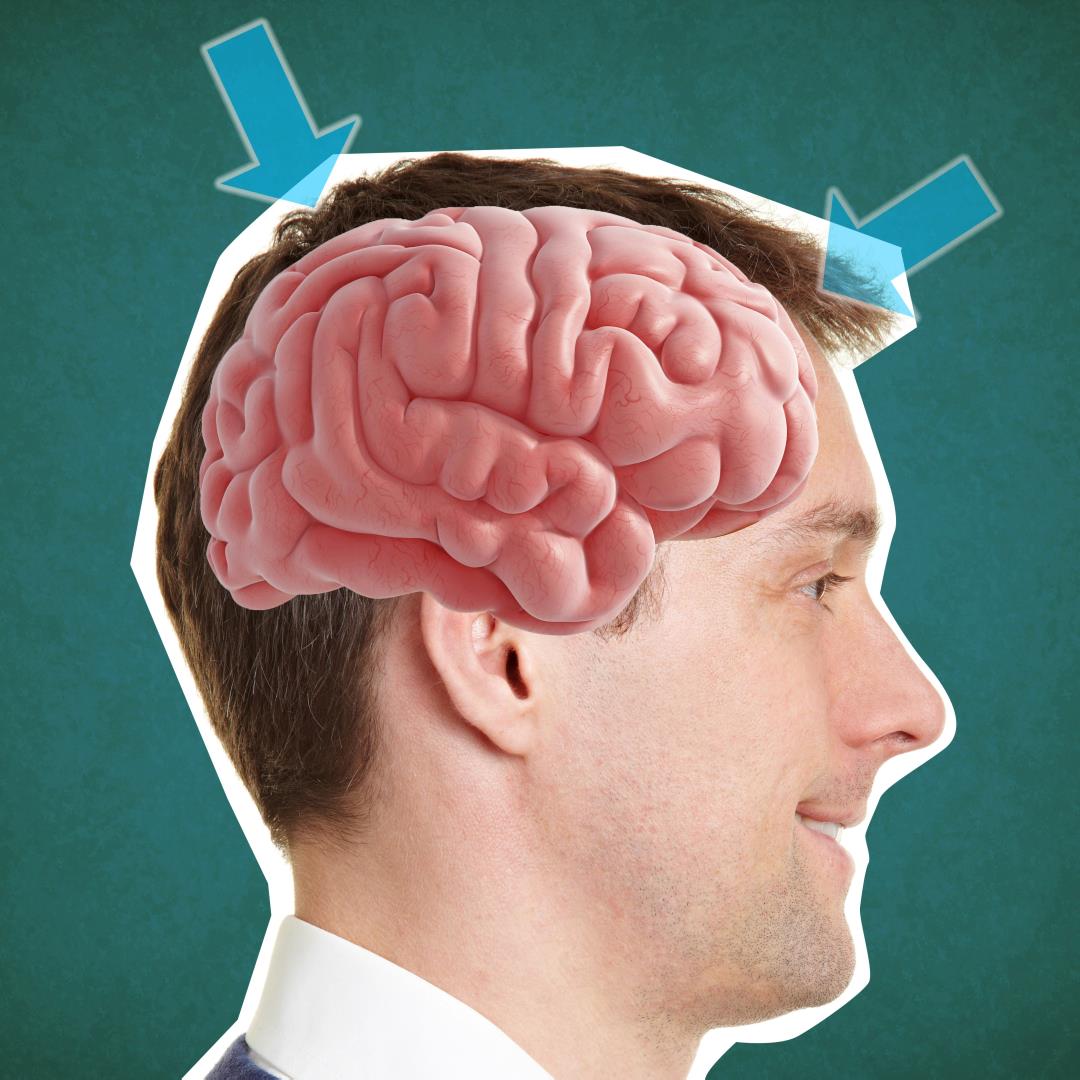



Zweifellos ist Sport gesund, Quali- und Quantität sollten dem Alter angemessen sein, weshalb auch die Altersgruppen angezeigt werden. Sie enden bei „65 Jahre“. Auch wenn „…und mehr“ geschrieben steht, fühle ich mich nicht gemeint, denn ich bin 83 Jahre alt und denke, dass im hohen Alter große Unterschiede bestehen und… Weiterlesen »
Mich würde interessieren, ob eine ähnliche Gefahr beim Üben von Judo- und Ringerwürfen besteht…
Das ist uns zunächst mal nicht bekannt. Es gibt einige Berichte mit wissenschaftlichen Bezügen dazu, wenn du mal suchst nach Schädel-Hirn-Trauma Judo.