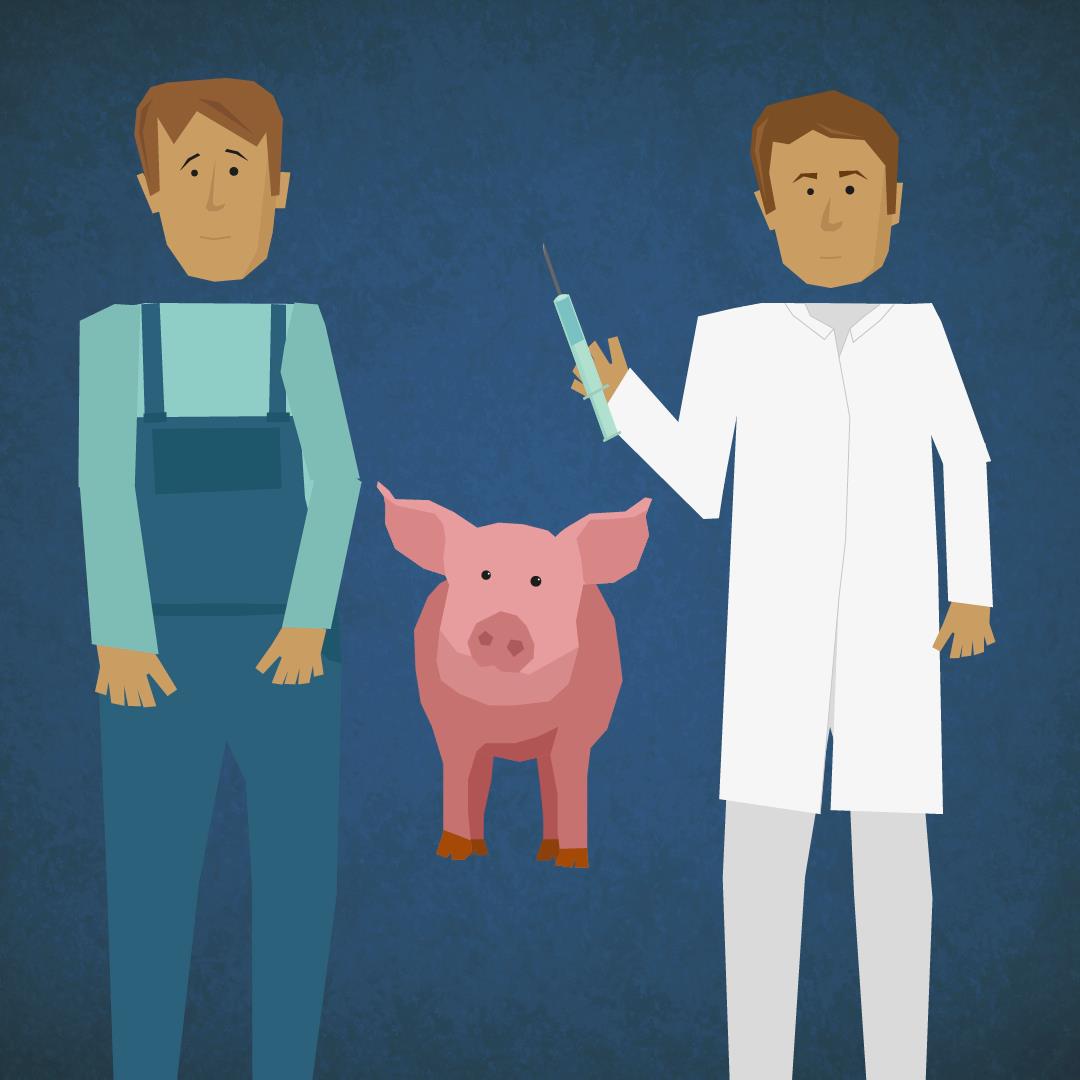Artikel Kopfzeile:
Hühnereier
Küken töten? Das sind die Alternativen
Seit dem 1. Januar 2022 darf in Deutschland kein Küken mehr wegen seines Geschlechts getötet werden. Doch das Problem ist nicht aus der Welt, denn im Ausland geht das Kükentöten weiter.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht's:
Darum geht's:
In Deutschland ist das Kükentöten mittlerweile verboten – im Ausland nicht
Bis Ende 2021 waren jährlich durchschnittlich circa 40 Millionen Küken getötet worden. Sie wurden getötet, weil sich nur weibliche Küken für die Eierproduktion eignen – so die bisherige Begründung. Als Masthähnchen bieten sich die männlichen Tiere einer auf das Eierlegen gezüchteten Rasse nicht an. Sie setzen zu wenig Fleisch an und sind für die Betriebe unrentabel. Daher wurden sie vergast oder geschreddert.
Kritische Bilanz nach dem Verbot
Anderthalb Jahre nach dem gesetzlichen Verbot zieht die Verbraucherschutzorganisation „Foodwatch“ kritisch Bilanz. „Zwar ist das Kükentöten seit 2022 in Deutschland verboten, aber das Verbot wird zu wenig kontrolliert und verfolgt. Wenn die männlichen Küken einfach zum Töten ins Ausland gekarrt werden, ist für den Tierschutz nichts erreicht”, sagt Annemarie Botzki von foodwatch. Nach Untersuchungen der Verbraucherschützer sind mindestens in einem Fall einer Brüterei aus NRW die männlichen Küken zur direkten Tötung ins Ausland exportiert worden. Die Landesregierung NRW bestätigte dies und sieht die bisherigen Regelungen als nicht ausreichend an.
Vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft hieß es schon vor der Umsetzung des Gesetzes, dass die Betriebe nicht mehr schredderten. Die männlichen Küken würden in einem zweistufigen Verfahren erst mit Kohlenstoffdioxid betäubt und anschließend mit einer höheren Dosis des Gases getötet.
So könnten sie als Ganzes an Zoos und Haustierbesitzer als Tierfutter verkauft werden. Vor allem Raubtiere wie Greifvögel und Schlangen, aber auch Haustiere wie Katzen und Frettchen fressen die Küken. Dass Eintagsküken weiterverwendet werden und nicht umsonst sterben, führten Geflügelbetriebe häufig als Argument an.
Wie viele Küken tatsächlich verfüttert wurden, ist unklar
Allerdings ist nicht bekannt, wie viele der Millionen Küken die Unternehmen tatsächlich als Futtermittel weiterverkaufen und wie viele sie entsorgen. Christiane von Alemann vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft spricht von „einem Großteil“ der männlichen Küken. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann keine konkreten Zahlen nennen. Christian Däuble, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, geht jedoch davon aus, dass „der Bedarf an Küken zur Verfütterung deutlich geringer sein dürfte als die Anzahl an männlichen Eintagsküken“.
Bundesregierung setzt dem Kükentöten im Jahr 2022 ein Ende
Deutschland werde das erste Land sein, das dieses weltweite Problem löse, hatte Geflügelverbandspräsident Friedrich-Otto Ripke angekündigt. Tatsächlich wollte die Bundesregierung das Kükentöten schon bis zum Herbst 2019 gestoppt haben. Der im Januar 2021 von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgelegte Gesetzesentwurf beendete das Kükentöten aber erst Ende 2021.
Mittlerweile hat der Bundestag bereits eine Anpassung des Kükentöten-Verbots vorgenommen. Seit dem 1. Januar 2024 sollte es eigentlich ab dem 7. Bebrütungstag verboten sein, die Bebrütung männlicher Embryonen unter Zuhilfenahme der Geschlechtsbestimmung abzubrechen. Diese Regelung basierte aber auf einem wissenschaftlichen Kenntnisstand, der inzwischen überholt ist, heißt es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nach aktuellem Forschungsstand sei das Schmerzempfinden der Hühnerembryonen erst ab dem 13. Bebrütungstag nicht mehr ausgeschlossen. So hat es auch der Bundestag beschlossen und die Frist verlängert: Bis einschließlich zum 12. Bruttag ist die Tötung von Hühnerembryonen also erlaubt.
Im Ausland geht das Kükentöten weiter
Vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft gibt es Kritik am Gesetz. Die Bundesregierung würde einen nationalen Alleingang machen, der Wettbewerbsnachteile für die deutsche Geflügelwirtschaft bringe. Dieses Gesetz gelte nur für Brütereien in Deutschland. Ausländische Brütereien können weiterhin die männlichen Küken am ersten Lebenstag töten.
Tatsächlich bedeutet das Gesetz nicht, dass grundsätzlich für deutsche Eier keine Küken mehr getötet werden. Das liegt in erster Linie an der Arbeitsteilung, die viele Betriebe vornehmen, heißt es von der Verbraucherzentrale. Häufig finden das Schlüpfen und die Aufzucht der Küken in anderen Betrieben statt als später dann die Haltung und das Eierlegen der erwachsenen Tiere. Legehennenbetriebe in Deutschland können also Junghennen beziehen, die in ausländischen Brütereien geschlüpft sind, die auch weiterhin männliche Eintagsküken töten. Am Ende können die Eier dieser Legehennen als deutsche Eier verkauft werden, folgert die Verbraucherzentrale.
Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:
Darum müssen wir drüber sprechen:
Wissenschaftler arbeiten schon an der Lösung
Artikel Abschnitt:
Die Nah-Infrarot-Raman-Spektroskopie
Ein mögliches Verfahren dafür ist die sogenannte Nah-Infrarot-Raman-Spektroskopie. Dabei wird mit einem optischen Laser gearbeitet. Dieser kann 72 Stunden nach dem Legen das Geschlecht des Embryos im Ei ermitteln. Die Methode macht sich dabei die unterschiedliche Größe der männlichen und weiblichen Geschlechtschromosomen bei Hühnern zunutze.
Bei der Methode muss zunächst mithilfe eines Lasers ein kleines Loch in die Kalkschale des Eies geschnitten werden. Dann wird mit einem weiteren Laser, der eine geringere Lichtintensität besitzt, die eigentliche Spektroskopie durchgeführt. Die Forscher erkennen so, wie hoch der Anteil der Nukleinsäure bei dem Embryo ist oder wie die Proteine aussehen.
Nach der Analyse wird das Loch in der Schale mit einem Pflaster wieder verschlossen, wenn es sich um weibliche Küken handelt. Die männlichen Embryonen würden dagegen nicht mehr weiter bebrütet.
Die Kernspintomografie
An der TU München setzten Forscherinnen und Forscher auf die Kernspintomografie (MRT), wobei die Technik sowohl das Geschlecht als auch den Befruchtungsstatus bestimmt. Die Eierschale wird dabei nicht beschädigt. „Somit wird der Embryo nicht in der Entwicklung gestört und es entsteht keine potenzielle Eintrittspforte für Keime in das Ei, wie es bei anderen Methoden der Geschlechtsbestimmung der Fall ist“, sagen die Professoren Benjamin Schusser und Axel Haase. Millionenfach sei diese Technik in der Humanmedizin erprobt worden. Sie habe dabei keine negativen Effekte auf den Organismus gehabt, so die beiden Forscher.
Die Endokrinologie-Methode
Ein weiteres Projekt ist das sogenannte endokrinologische Verfahren, das Wissenschaftler der Universität Leipzig entwickelt haben. Dabei stechen die Forscher das Ei mit einer feinen Nadel an, nachdem es neun Tage lang angebrütet wurde. Die Nadel entnimmt Flüssigkeit, welche die Forscher in einen Marker geben. Dieser zeigt ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest an, ob der Embryo weiblich oder männlich ist. Der Embryo bleibt bei dem Verfahren laut der Entwickler unversehrt. Das Einstichloch ist so klein, dass es nicht verschlossen werden muss. Das endokrinologische Verfahren wird bereits angewandt und weiterentwickelt.
Die Genschere CRISPR/Cas
Bei dieser Methode erhalten Hennen mit der sogenannten Genschere CRISPR/Cas ein markierendes Gen, das allerdings nur auf die männlichen Eier übertragen wird. Werden diese Eier unter UV-Licht gehalten, beginnen sie zu leuchten und können aussortiert werden. Die weiblichen Eier werden hingegen ausgebrütet.
Unternehmen aus Israel und Australien arbeiten an dieser Methode. In Israel strebt man eine kommerzielle Nutzung für 2024 oder 2025 an. Innerhalb der Europäischen Union scheint dieses Verfahren aber ohnehin kein Lösungsansatz zu sein. Hier gelten die Eier als gentechnisch verändert und dürfen deshalb nicht verkauft werden.
Artikel Abschnitt: Aber:
Aber:
Die Alternativen sind noch zu aufwendig und teuer
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Weiterforschen, weiterforschen, weiterforschen
Was du über das kurze Leben eines Hähnchens wissen musst
Fleisch und Eier aus einer Rasse
Sogenannte „Zweinutzungshühner" stammen aus einer bestimmten Rasse, bei denen sowohl die Hähne als auch die Hennen genutzt werden. Die Hennen legen weniger und teilweise kleinere Eier als gewöhnliche Legehennen. Die Hähne wachsen langsamer und werden nicht so groß wie konventionelle Masthühner. Trotzdem können Betriebe sowohl die Eier als auch das Fleisch verkaufen.
Diese Zweinutzungshühner zu etablieren, ist das langfristige Ziel. Bis es jedoch so weit ist, können wir Eier aus Bruderhahn-Initiativen kaufen.
Das Prinzip funktioniert so, dass die männlichen Küken aus der Legehennenzucht nicht direkt nach der Geburt getötet werden, sondern weiterleben. Das ist allerdings teurer als bei männlichen Küken aus Mastzüchtungen, da die Küken aus der Legehennenzucht weniger Fleisch ansetzen. Deswegen kosten die gelegten Eier der Schwestern im Durchschnitt 4 Cent mehr: Durch diesen Aufpreis wird das Futter ihrer Küken-Brüder finanziert, wodurch auch ihre längere Mastzeit für den Landwirt kein finanzielles Problem mehr darstellt und das Fleisch der Bruderhähne zu normalen Preise angeboten werden kann.
Denn die Mast ist fast 3,5 Mal länger als bei Hühnern aus Mastzüchtungen: bis zu 22 Wochen anstatt der normalerweise 42 Tage (bei einer Langmast). Aber auch die Hennen aus der Bruderhahn-Initiative finden noch Verwendung und werden als Suppenhühner verkauft. Als Grillhähnchen eignen sich die mageren Tiere nicht.
Bruderhahn-Eier gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt, sogar aus konventioneller Landwirtschaft. Das Bruderhahn-Fleisch gibt es vor allem im Biomarkt und es ist deutlich zäher als die klassische konventionelle Hähnchenbrust.
EU-weites Kükentöten-Verbot angestrebt
Da in anderen Ländern der EU sowie weltweit weiterhin das Töten männlicher Küken gängige Praxis ist, setzen sich Tierschützer:innen für ein EU-weites Verbot des Kükentötens ein. Bisher haben Frankreich, Österreich und Luxemburg nationale Beschränkungen.
Die EU-Kommission hat auf eine französisch-deutsche Initiative hin angekündigt, einen Vorschlag für eine EU-weite Beendigung des Kükentötens vorzulegen.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift: