Artikel Kopfzeile:
Umstrittener Weißmacher
Darum gehört Titandioxid nicht in Lebensmittel
Ab Sommer 2022 darf Titandioxid nicht mehr in Lebensmitteln eingesetzt werden. Der Grund für das Verbot: mögliche Krebsrisiken.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht’s:
Darum geht’s:
EU verbietet Titandioxid
Man konnte den Zusatzstoff bisher auch noch in Schokolinsen, Kaugummis, Mayonnaise, Mozzarella, Marshmallows oder leuchtendem Zuckerguss (für die Backprofis: Fondant) ausfindig machen. Doch damit soll nun Schluss sein. Denn die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat entschieden: Ab dem Sommer 2022 darf das Weißpigment nicht mehr in Lebensmitteln eingesetzt werden. Das gilt für alle Länder in der EU. „Die Lebensmittelsicherheit und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger sind nicht verhandelbar“, teilte die zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides mit. Mit dem Verbot beseitige die EU einen Lebensmittelzusatzstoff, der nicht mehr als sicher gelte.
Die Bezeichnung für den Zusatzstoff in Lebensmitteln lautet bisher: E171 –dieser Code verschwindet von den Produktverpackungen. Die Branche hat den Stoff bisher eingesetzt, um Lebensmittel „(…) glänzender und frischer aussehen (…)“ zu lassen, sagt Heidrun Schubert, Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern. In Kosmetika darf Titandioxid weiter eingesetzt werden. Dort versteckt sich das Weißpigment hinter der Bezeichnung CI 77891.
Während sich Großbritannien dem neuen EU-Verbot nicht anschließen möchte und den Weißmacher in Lebensmitteln weiter erlaubt, wird der Stoff auch in der Schweiz als nicht mehr sicher eingestuft.
Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:
Darum müssen wir drüber sprechen:
Nanopartikel können in Zellen eindringen
Darmpatienten sind besonders gefährdet
Am Universitätsspital Zürich erforscht Gastroenterologe Rogler, welche Wirkung Nanopartikel aus Titandioxid auf unseren Darm haben. Die Ergebnisse der Forschung aus der Schweiz deuten auf ein Risiko für Patienten, die anfällig für Darmentzündungen sind, hin.
"Zwei Prozent der Bevölkerung haben das Risiko, eine Darmentzündung zu entwickeln", sagt Rogler und ergänzt: "Da muss man dann politisch entscheiden, ob die Zahl hoch genug ist, damit man etwas unternimmt. Das Risiko, an Masern zu erkranken, ist auch nicht hoch – dennoch diskutiert man aus guten Gründen eine Impfpflicht."
Zur Studie: Titandioxid-Nanopartikel können Darmentzündungen verstärken.
Roglers Forschung aus dem Jahr 2017 zeigt: Prallen Titandioxid-Nanopartikel direkt auf die Zellmembran, dann funktionieren sie wie kleine Geschosse, die die Membran durchdringen und Entzündungsvorgänge auslösen können.
Diese Form von Reizung kann letztlich zur Entstehung von Tumoren führen. In einem weiteren Schritt verabreichten die Schweizer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch Mäusen Titandioxid-Nanopartikel. Auch bei den Mäusen konnten die Partikel ins Zellinnere vordringen, was zu einer Darmentzündung und zu einer größeren Schädigung der Darmschleimhaut führte. Zudem reicherten sich Titandioxid-Kristalle in der Milz der Tiere an.
Ratten-Studie: Nanopartikel gelangten ins Blut
Im Jahr 2017 hatten französische Forschende bei Ratten nachgewiesen, dass eine Einnahme von E171 Darmentzündungen hervorrufen kann und dem Immunsystem schadet. In den Versuchen wurde gezeigt, dass Titandioxid-Nanopartikel ins Blut gelangen könnten.
Allerdings sei eine Übertragung der Ratten-Studie auf Menschen nicht ohne Weiteres möglich. Es handele sich zuvorderst um eine Studie zur Gewinnung von wissenschaftlichen Daten, nicht um eine Risikoanalyse, so die Forschenden aus Frankreich. Aber ein Risiko, dass Titandioxid die Zellen schädigt, konnte eben auch nicht ausgeschlossen werden. Und deshalb gilt das Vorsichtsprinzip und das Verbot für Lebensmittel ab Sommer 2022. Es heißt, dass eine „Genotoxität“ nicht ausgeschlossen werden könne. Als genotoxisch werden immer solche Zusatzstoffe bezeichnet, die das Erbgut, also die DNA, schädigen können.
Zur Studie:
Food additive E171: first findings of oral exposure to titanium dioxide nanoparticles.
Europe to ban Titanium Dioxide (Food Safety Magazine)
Risiko beim Einatmen
Nicht nur die Aufnahme durch Lebensmittel gilt als problematisch: Wird Titandioxid eingeatmet, kann der Weißmacher gesundheitsschädlich sein, etwa wenn durch Lacke Abrieb in die Luft gelangt. In solchen Fällen wird Titandioxid von der europäischen Chemikalienbehörde ECHA als ʺvermutlich krebserregendʺ eingestuft.
Daher hat die EU-Kommission im Februar 2020 Titandioxid als Gefahrenstoff mit dem Zusatz ʺvermutlich krebserzeugend bei Inhalationʺ eingestuft. Steckt in flüssigen Gemischen ein Prozent Titandioxidpartikel (Durchmesser von zehn Mikrometer), muss es folgenden Hinweis geben: ʺAchtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.ʺ
Artikel Abschnitt: Aber:
Aber:
Titandioxid kann auch Vorteile haben
Titandioxid-Partikel stecken auch in einer besonderen Art von Sonnencreme, die oft als Sonnencreme für Kinder verkauft wird. In dieser befinden sich kleine, weiße Titandioxid-Partikel, die nicht in die Haut einziehen und die Sonne reflektieren. Deshalb schimmert die Haut bei der Verwendung solcher Cremes oft noch weiß. Die kleinen Teilchen auf der Haut wirken wie ein Sonnenschirm.
In Sonnenmilch für Erwachsene sind hingegen chemische Filter enthalten, die in die obere Hautschicht eindringen und die ultraviolette Strahlung der Sonne in Wärme umwandeln. Bei Sonnencremes greift die Kosmetikverordnung, wonach nur bestimmte Nanoformen von Titandioxid zugelassen sind. Dabei sei aber immer die aktuell gültige Fassung der Kosmetikverordnung zu berücksichtigen, so das BfR.
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Datenlücken weiter schließen
Letztlich geht es um einen Zusatzstoff, der einfach nicht essenziell ist. Muss ein Kaugummi strahlend weiß sein? Nein. Muss eine Zahnpasta immer weiß sein? Nein, solange auch graue Pasten die Zähne gut reinigen (die gibt es ja auch schon). Gehört Titandioxid in Mozzarella? Darin hat es absolut nichts zu suchen.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:

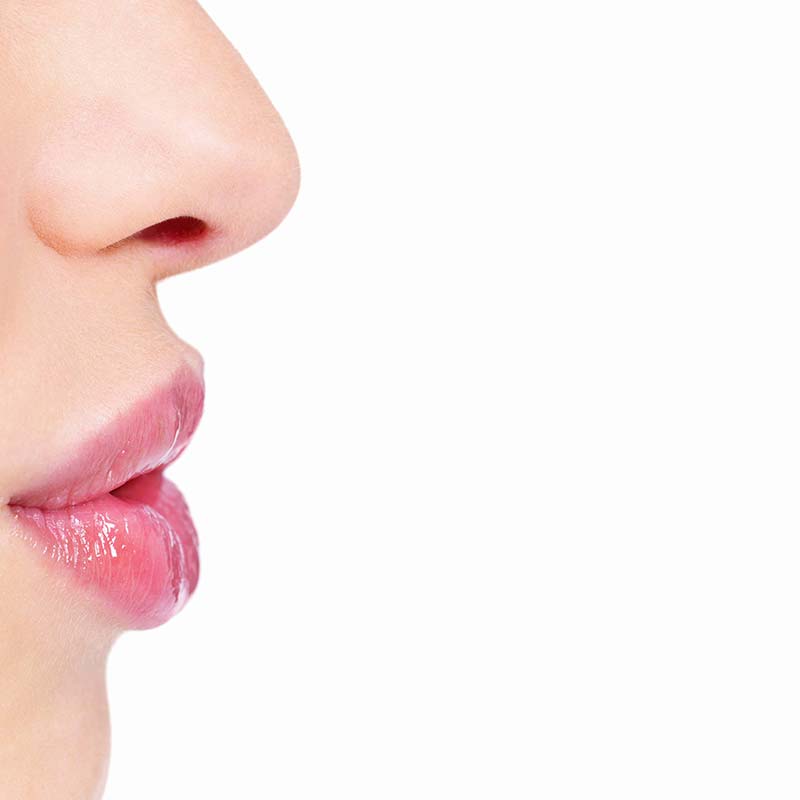




Wie sieht es z.b bei Medikamenten aus, die werden ja auch über den Magen Darm Trakt übernommen. Hab neulich auch ein Artikel gelesen, indem stand das Titannanopartikel, wie kleine Geschosse die Zellwände durchstoßen und Entzündungen auslösen. Jetzt gerade bei dem Medikament Sinupret /- Extrakt habe ich meine Bedenken. Da diese… Weiterlesen »
In der Tat ein wichtiges Thema und eine wichtige Frage. Dass Titandioxid hier weiterhin in vielen Pillen enthalten ist, liegt wohl daran, dass die Zusammensetzungen von Medikamenten nicht so einfach zu verändern sind, weil sie bisher nur genau in dieser zugelassen sind. Expert:innen schätzen, dass hier eine Umstellung des gesamten… Weiterlesen »
Interessant ist, dass es bei einzelnen Medikamenten Generika gibt, die gänzlich ohne Titandioxid auskommen, z.B. beim Cholesterinsenker Atorvastatin (einzelne Hersteller) oder beim Blutverdünner ASS. Und trotzdem sind diese Tabletten reinweiß. Es geht also auch ohne. Das ebenfalls oft hervorgeholte Argument, dass Titandioxid die Sicherheit der Medikamente erhöht, indem es den… Weiterlesen »
Warum wurde diese Studie vom Februar 22 nicht beachtet, wenn der Artikel im März 22 aktualisiert wurde? Wenn Titandioxid nicht eingeatmet werden, dann haben wir laut dieser Studie ein Problem. https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w
Danke dir für die Studie. In dem Artikel ging es vor allem um die Auswirkungen von Titandioxid in Lebensmitteln. Wir haben den Artikel aktualisiert, weil die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) das Weißpigment seit diesem Sommer in Lebensmitteln verbietet. Das Maskenthema ist nicht Kern des Textes. Die Studie schauen wir… Weiterlesen »
Warum wird hier im Artikel nicht der Mechanismus der Wirkungsweise erläutert? Was macht denn TiO2 genau in den Zellen? Ist die negative Wirkung physikalischer oder chemischer Natur? Oder macht die Dosis das Gift. TiO2 ist eine sehr stabile Verbindung, sodass sich Ti in der Umwelt quasi selbst Passivität und somit… Weiterlesen »
Warum wird das nicht europaweit verboten? Sind wir EU oder nicht!
Dieser Artikel erfüllt in keinster Weise die Kriterien für guten Wissenschaftsjournalisms: Er wählt aus einer ca. 15000 Studien umfassen wissenschaftlichen Datenbank an Studien mit Titandioxid subjektiv welche aus ohne die Verlässlichkeit und Relevanz der publizierten Daten zu überprüfen. Das wird vervollständigt mit Meinungen von zwei zufällig ausgewählten „Experten“. Ich kann… Weiterlesen »
Natürlich prüfen wir die Verlässlichkeit und Relevanz der Studien, auf die wir uns beziehen, und wir wählen die zitierten Experten bewusst anhand ihres Fachwissens zu einem Thema aus. Wie kommst du darauf, dass wir das nicht tun? Welche wissenschaftliche Einschätzung fehlt dir konkret in unserem Artikel?
Der Herr hat Recht, Quarks Artikel vom 17. Juli 2019 – 13. August 2020 Wissenschaftliche Artikel vom Freitag, 21. Juli 2017 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/77148/Titandioxid-Nanopartikel-Wie-gefaehrlich-ist-E-171-fuer-Darmpatienten Siehe letzte Kommentar: hdlahl am Donnerstag, 19. September 2019, 19:09 Blood levelsof titanium dioxide Sehr geehrte Damen und Herren, Titandioxid geht durch die Darmwand auch ohne das sie… Weiterlesen »
Wenn es tatsächlich 1500Studien gibt,warum bleibt es tatsächlich unerwähnt und wie relevant sind Nanopartikel tatsächlich,da es überall zu finden ist.Primär ernähren sich die meisten Menschen falsch und ungesund,dies scheint mir wichtiger als wieder mal Verbote wo hingegen gehärtete Fette und Palmfett weiterhin in zu großen Mengen verzehrt wird.Es erscheint mir… Weiterlesen »
Bei den Tabletten handelt es sich um Mikropartikel, nicht um Nanopartikel (siehe Artikel).