Artikel Kopfzeile:
Antikörper, T-Zellen, Booster
Corona: Wie lange sind wir immun?
Neue Varianten, mehrfach infiziert, Impfung schon lange her: Wie lange schützen uns Impfung und Infektion?
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt:
Das Wichtigste in Kürze:
- Eine Infektion mit der Omikron-Variante bietet offenbar keinen zuverlässigen Schutz vor anderen Varianten.
- Nach drei Kontakten mit dem Coronavirus, entweder durch Impfung oder durch Infektion, scheint man einen guten Immunschutz aufgebaut zu haben.
- Der Schutz vor schweren Verläufen ist nach der Booster-Impfung weiter hoch, der Schutz vor Infektion sinkt deutlich schneller wieder.
Artikel Abschnitt: Wie funktioniert der Immunschutz überhaupt?
Wie funktioniert der Immunschutz überhaupt?
Erste Defensive: Attacke auf alles, was fremd ist
Auch T-Zellen (weiße Blutkörperchen) sind im Spiel:
- T-Killerzellen entdecken infizierte Zellen und zerstören sie. Die Vermehrung der Viren wird verlangsamt oder gestoppt.
- T-Helferzellen erkennen fremde Virusbestandteile und vermitteln anschließend über B-Zellen die Bildung der Antikörper Immunglobulin G (IgG). Sie leiten die zweite Defensive ein.
Artikel Abschnitt:
Zweite Defensive: Präzise Attacken
Jetzt legt das erworbene Immunsystem los – über Antikörper, T-Zellen und B-Zellen. In den Lymphknoten werden unglaublich viele verschiedene Antikörper des Typs IgG produziert. Nicht alle davon passen genau auf die Angriffspunkte des Coronavirus, doch mit der Zeit setzen sich die maßgeschneiderten Antikörper durch. Dabei spricht man von einer Affinitätsreifung.
Das heißt: Über Wochen wird die Immunantwort auf das Coronavirus immer besser. Die Menge an IgG-Antikörpern ist ein Indikator dafür, wie gut der Körper eine erneute Infektion abwehren kann. B-Gedächtniszellen speichern die Informationen und können bei einer erneuten Infektion schnell wieder die passenden Antikörper (IgG) bilden, um das Virus zu bekämpfen.
Während sich die erste Defensive insbesondere mit der Bekämpfung von Infektionen beschäftigt, verhindert das erworbene Immunsystem durch präzise Attacken schwere Verläufe. Beide Teile arbeiten Hand in Hand.
Weitere Angaben zum Artikel:
Der Immunschutz ist nicht bei allen gleich
- Alter und Gesundheit der Person:
Mit steigendem Alter nimmt die Immunantwort ab. - Verlauf der Infektion:
Es bilden sich meist mehr Antikörper nach einem schweren Verlauf. - Kreuzimmunität:
Der Kontakt zu anderen Coronaviren vermittelt einen Teilschutz.
Wie gut schützt die Impfung vor Infektionen?
Der Impfschutz hängt ebenfalls von mehreren Faktoren ab:
- Alter und Gesundheit der Person:
Mit steigendem Alter sinkt die Immunantwort. Immungeschwächte Menschen entwickeln weniger Antikörper. - Impfstoff:
Die Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe und Typen unterscheidet sich. - Impfschema:
Zu kurze oder zu lange Abstände zwischen den Dosen können die Effektivität verringern.
Artikel Abschnitt: Wie lange ist man vor einer Infektion mit Covid-19 geschützt?
Wie lange ist man vor einer Infektion mit Covid-19 geschützt?
Klar ist: Die Impfungen bieten keine sterile Immunität, die Infektionen vollständig verhindern kann. Da die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht 100 Prozent beträgt, war immer zu erwarten, dass es auch unter Geimpften Infektionen geben wird.
Trotzdem infizierten sich Geimpfte mit den älteren Varianten deutlich seltener als Ungeimpfte: Die durchschnittliche Wirksamkeit der Impfstoffe gegen eine symptomatische Infektion mit der Delta-Variante lag bei etwa 75 Prozent.
Seit Omikron nimmt der Schutz vor Infektion deutlich schneller ab
Beobachtungen zeigen, dass der Impfschutz gegen Omikron-Varianten nicht nur generell geringer ist als gegen vorherige Varianten – er nimmt auch nach wenigen Monaten deutlich ab: Daten aus 2022 aus England zeigen, dass die mRNA-Impfstoffe nach etwa fünf Monaten nur noch zu zehn Prozent vor einer symptomatischen Infektion schützen.
Allerdings sind solche Prozentangaben zum Schutzeffekt inzwischen extrem schwierig, weil es kaum noch Menschen gibt, die nicht infiziert waren – ob geimpft oder nicht. Wie lange es dauert, bis man sich nach durchgemachter Infektion wieder anstecken kann, kann man wegen der verschiedenen Varianten und dem unterschiedlichen Immunschutz leider nicht pauschal beantworten.
Warum das Konzept der Herdenimmunität unrealistisch ist, erklären wir hier.
Geimpfte sind weniger ansteckend
Stecken sich geimpfte Menschen an, scheint die Menge der weitergegebenen Viren (Viruslast) niedriger zu sein als bei ungeimpften Menschen – allerdings zeigt sich der Effekt wohl erst ab der dritten Impfung.
Das zeigen Studien von 2022 und 2023, die in den Fachmagazinen „Nature Medicine“ und „Nature Communications“ veröffentlicht wurden. Wie das jetzt bei Menschen ist, die zwar dreimal geimpft sind, bei denen die letzte Impfung aber schon zwei Jahre her ist – dazu gibt es noch keine Daten.
Artikel Abschnitt: Wie lange hält der Schutz vor schweren Verläufen?
Wie lange hält der Schutz vor schweren Verläufen?
Die Booster-Impfung hat den Schutzeffekt signifikant verstärkt: Sie reduzierte das Risiko, mit einem schweren Verlauf ins Krankenhaus zu müssen, in allen Altersgruppen um ungefähr 90 Prozent. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC kam zu ähnlichen Ergebnissen und nahm vorerst an, dass der Schutz vor schweren Verläufen durch Omikron nach vier Monaten bei 66 bis 78 Prozent liegt – im Vergleich mit Ungeimpften.
Immunität mittlerweile sehr unterschiedlich
Inzwischen hat sich die Immunitätslage natürlich sehr verändert und unterscheidet sich stark: Menschen sind unterschiedlich oft geimpft, viele waren schon mehrfach infiziert, manche nicht. Deshalb ist es gar nicht mehr so leicht, Aussagen zum Schutzeffekt zu treffen, die für alle gelten.
In der aktuellen Beurteilung der Stiko sind verschiedene Studien eingeflossen, in denen die Teilnehmenden zwei bis vier Impfstoffdosen der „alten“ Impfstoffe erhalten und teilweise eine oder mehrere Infektionen durchgemacht hatten.
Bei einer (weiteren) Auffrischungsimpfung mit einem an die Omikronvarianten BA4/BA5 angepassten Impfstoff konnte insgesamt ein Schutz von 62 Prozent vor einem schweren Covid-19-Verlauf festgestellt werden – verglichen mit Menschen, die keine weitere Auffrischungsimpfung erhalten hatten. Zu den Impfstoffen, die schon an neuere Varianten angepasst sind, gibt es noch keine Daten aus der realen Welt.
Warum sinkt der Schutz?
Weil die Zahl der Antikörper nach einer Impfung mit der Zeit sinkt – dadurch steigt das Risiko, sich doch mit dem Virus anzustecken. Nach der Bekämpfung eines Erregers, sowohl bei einer Infektion als auch bei einer Impfung, schaltet der Körper in seine Defensive für einen längerfristigen Schutz um. Das ist ganz natürlich, denn so muss er nicht Unmengen an Antikörper gegen jedes Virus und jede Virusvariante produzieren, die sich dann im Blut tummeln. Stattdessen wird die Immunabwehr verschlankt und effizienter gemacht.
Dabei spielen Gedächtniszellen eine besondere Rolle. B-Gedächtniszellen können bei einer erneuten Infektion schnell wieder die passenden Antikörper (IgG) bilden, um die Virusvermehrung einzudämmen. Bei neuen Virusvarianten aber gibt es erstmal weniger passende Antikörper, je nach Veränderung der Variante.
Neben Antikörpern spielen T-Zellen eine wichtige Rolle
T-Zellen reagieren auf weit mehr Stellen des Coronavirus (sogenannte Epitope) als die speziellen Antikörper. Auch neue Varianten werden in der Regel von ihnen erkannt und bekämpft. Denn: Ihre Konzentration bleibt nach anfänglicher Abnahme über einen sehr großen Zeitraum auf demselben Niveau. So lange bleibt auch ein Schutz vor schweren Verläufen gegeben.
Wie lange, das ist noch nicht endgültig geklärt. Forschende haben jedoch in mehreren Studien Immunzellen im Knochenmark gefunden. Damit könnten diese Gedächtniszellen ein Leben lang Antikörper produzieren, wenn es nötig wird. Inwiefern das bei allen Menschen auch ein Leben lang vor schweren Verläufen schützt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Jede Infektion erneuert den Schutz
Der einzige Makel: Diese langfristigen Immunantworten springen erst nach einer Infektion wieder an. Sowohl Genesene als auch Geimpfte können sich daher wieder anstecken und das Virus mitunter verbreiten, ehe es wieder vollständig zerstört wird. Dann springen aber auch die frühen Immunreaktionen mit an und geben wieder einen Schutz vor neuen Infektionen.
Forschende wie der Virologe Christian Drosten und der Biochemiker Manuel Wyler sehen deshalb für die Zukunft einen Meilenstein in der Entwicklung eines Lebendimpfstoffes, der direkt über die Nase verabreicht wird. Hierbei handelt es sich um eine abgeschwächte Form des Virus, die sich ähnlich wie das Original vermehren kann. So wird bereits in der Schleimhaut ein umfassender Immunschutz aufgebaut, der vor Infektionen schützt. Entsprechende Impfstoffe werden gerade entwickelt.
Artikel Abschnitt: Unterscheidet sich der Immunschutz nach Infektion und Impfung?
Unterscheidet sich der Immunschutz nach Infektion und Impfung?
Trotzdem gibt es einen Unterschied: Anders als bei einer Infektion mit dem Virus transportieren die Impfstoffe lediglich das Spike-Protein oder den Bauplan dafür in die Zellen. Dadurch reagiert das Immunsystem dann nicht auf mehrere Stellen des Virus, sondern vor allem auf das wichtige Spike-Protein, mit dem das Virus in die Zellen eindringt.
Schlechtere Immunität nach Omikron-Infektion?
Prinzipiell gilt daher: Bei Genesenen sollte die Immunreaktion eigentlich breiter ausfallen, weil die Abwehrzellen darüber hinaus noch mehr Bestandteile des Virus kennengelernt haben. Das könnte – theoretisch – auch bei der Abwehr von neuen Varianten helfen, wenn sich zwar das Spike-Protein verändert, die übrigen Bestandteile aber nicht.
Tatsächlich zeigt sich aber auch, dass der Körper gegen Virus-Bestandteile vorgeht, die für das Eindringen in die Zelle keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass vor allem neutralisierende Antikörper gebildet werden, die das Spike-Protein blockieren und das Virus gar nicht erst in die Zelle lassen.
Dieser Schutzfaktor ist nach Impfungen höher als nach einer Infektion, besonders wenn Letztere mild oder asymptomatisch verläuft. Seit der Omikron-Variante mit vielen milderen Verläufen mehren sich hier nun die Hinweise, dass der alleinige Immunschutz nach einer Infektion sogar schlechter ist als nach einer Impfung – besonders gegen andere Varianten.
Hat man sich also erst infiziert, als die Omikron-Varianten dominiert haben, und ist nicht geimpft, ist man vermutlich nicht besonders gut vor weiteren Corona-Infektionen mit anderen Varianten geschützt. Aktuell gibt es unter den bekannten Varianten nur Abkömmlinge von Omikron – aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch andere Varianten wieder durchsetzen.
Artikel Abschnitt: Was ist Kreuzimmunität?
Was ist Kreuzimmunität?
Einige Arbeiten sprechen auch von einer "memory response": Das Immungedächtnis wird aktiv. Dies wird Kreuzimmunität oder auch Kreuzreaktivität genannt. Das bedeutet, dass T-Zellen, die gegen andere saisonale Coronaviren gebildet wurden, auch auf SARS-CoV-2 reagieren. Womöglich könnte das einen Teil der Menschen vor schweren Verläufen schützen.
Enttäuschende Kreuzimmunität nach Omikron-Infektion
Tier- und Laborexperimente ergaben, dass Antikörper, die nach einer Infektion mit einer neueren Variante – also seit Omikron – gebildet werden, auch nur Omikron-Viren neutralisieren. Aktuell gibt es auch nur Omikron-Varianten – aber das kann sich natürlich auch wieder ändern. Es ist also davon auszugehen, dass ungeimpfte Personen nach einer Omikron-Infektion nur einen unzureichenden Schutz gegen andere (potenziell gefährlichere) Varianten aufweisen.
Warum sich manche Menschen nicht mit Corona anstecken, erklären wir hier.
Artikel Abschnitt: Neue Varianten und neue Impfungen: Brauchen wir sie?
Neue Varianten und neue Impfungen: Brauchen wir sie?
Eine Studie aus Großbritannien konnte zwar eine etwas positivere Bilanz ziehen, im Vergleich zum Booster nach der Zweitimpfung scheint die Wirkung eines weiteren Boosters jedoch deutlich verringert.
Erneute Impfung für Risikogruppen
Für Risikogruppen, die ihren Impfschutz nur unvollständig aufbauen und schneller abbauen, ist eine jährliche Impfung durchaus sinnvoll – sie erhöht nachweislich den Schutz vor schweren Verläufen und Tod. Die Stiko empfiehlt sie deshalb unter anderem für Menschen ab 70 Jahren oder mit Immundefizienz.
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:


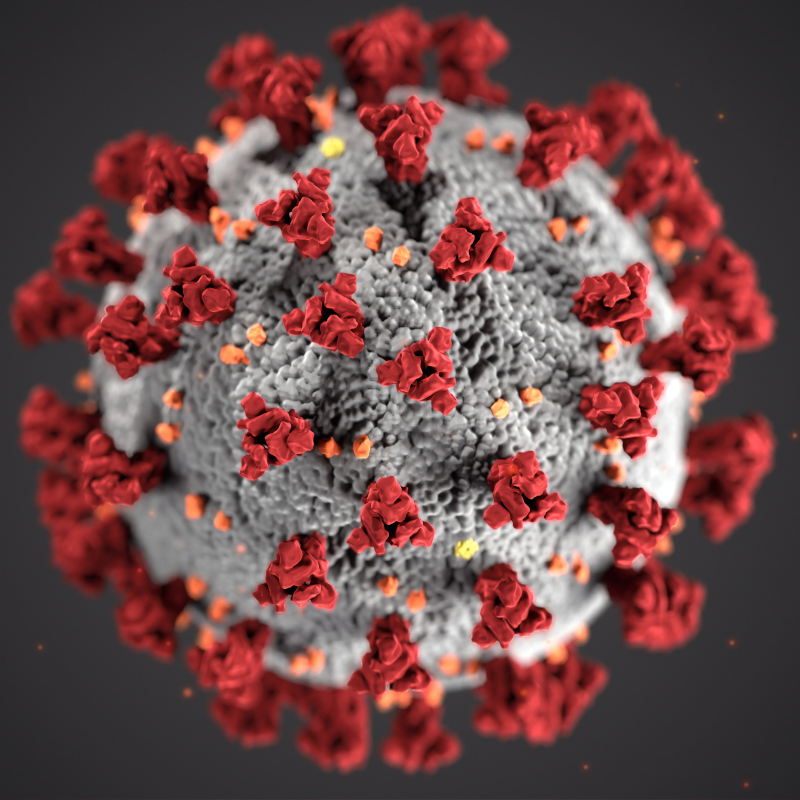



Guten Abend, also ich habe im September meine 6. coronaimpfung bekommen. Nun habe ich seid 5 tagen Corona. Ich muss dazu sagen es ist nur leichtes Fieber (38,3*), leichter Husten und sogenannten Schnupfen. Hoffe das es dabei bleibt. Gruß Trudi
Für mich ist die ganze Diskussion über Corona und etwaige Infektionen und Impfungen mittlerweile völlig überflüssig und sinnlos. Es gibt immer solche und solche Erfahrungen, die jeder individuell für sich selbst oder innerhalb seiner sozialen Kontakte macht. Ich bin 46 Jahre alt, männlich, lebe weder völlig ungesund noch völlig gesund,… Weiterlesen »
Du schreibst, wie es dir bisher mit Corona ergangen ist. Daraus – und aus dem, was du im Bekanntenkreis mitbekommen hast – lässt sich leider nicht ableiten, ob die Impfung wirkte oder nicht. Dazu braucht es eine sehr große Menge an Vergleichsdaten.
Die Quellenliste besteht zu 90% aus Quellen und Erkenntnissen von 2020/21. Einige Links funktionieren schon gar nicht mehr, weil die Aussagen überholt sind und aus dem Netz genommen wurden, aber hier stehen die mittlerweile widerlegten Annahmen von 2020/21 noch so da, als wären sie immer noch wissenschaftlicher Standard. Statt den… Weiterlesen »
Welche Links funktionieren bei dir nicht?
Hier wird viel über T-Zellen zu Virenbekämpfung geschrieben, aber nicht erwähnt, dass diese nur aktiv werden können, wenn sie sich über einen Rezeptor Vitamin-D aus dem Blut greifen können. —- Universität Kopenhagen 2010 „Sonne unverzichtbar für starkes Immunsystem“ …T-Zellen brauchen unbedingt ausreichende Mengen an Vitamin D im Blut, um in… Weiterlesen »
Wie immer gibt es Ausnahmen. Wir sind als Familie im November trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt. Auch unsere 11jährige Tochter, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft werden konnte. Alle mit Krankheitssymptomen wie bei einer Grippe. Heute haben wir ein erneutes positives Testergebnis bei unserer Tochter bekommen. Genau 90… Weiterlesen »