Artikel Kopfzeile:
Diskriminierung oder Sicherheitsmaßnahme?
Warum manche Leute nicht Blut spenden dürfen
Frisch Tätowierte, Reisende oder Männer, die Sex mit Männern hatten, werden von der Blutspende ausgeschlossen. Viele Regeln sind nachvollziehbar. Doch nicht alles.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht’s:
Darum geht’s:
Nicht alle dürfen Blut spenden
Der Ursprung dieser Regelung liegt weit in der Vergangenheit: In den 80er-Jahren waren Blutspenden dafür verantwortlich, dass sich Viren in der Gesellschaft verbreitet haben, zum Beispiel das für AIDS verantwortliche Humane Immundefizienzvirus (HIV). Spender haben die Viren an den Empfänger übertragen. Seitdem hat die Infektionssicherheit bei Blutspenden mit die höchste Priorität. “Selbst wenn es zu einem Mangel an Blutkonserven käme, wäre das keine Begründung dafür, bei der Sicherheit Abstriche zu machen”, schreibt etwa das Paul-Ehrlich-Institut, das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.
Das Blut muss infektionsfrei sein
In Deutschland werden jährlich etwa sieben Millionen Blutspenden abgegeben. Oberstes Gebot ist: Spender und Empfänger dürfen bei einer Blutspende nicht gefährdet werden. “Die Blutkonserven werden Menschen verabreicht, die sowieso schon krank oder geschwächt sind”, sagt Susanne Stöcker, Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts. Es sei wichtig, dass sie durch das gespendete Blut nicht noch eine Krankheit bekommen.
Deshalb wird jede einzelne Konserve im Labor auf Viren, Bakterien oder andere Erreger untersucht. “Die Nachweistests sind heutzutage hoch spezifisch und empfindlich”, sagt Susanne Stöcker. Trotzdem gebe es keine hundertprozentige Sicherheit, dass eine Blutkonserve risikofrei ist. “Doch durch die vielen Maßnahmen, die wir treffen, sind wir sehr nah dran.” Eine Maßnahme ist es, Personengruppen mit einem erhöhten Risiko für Erreger im Blut von der Spende auszuschließen. Die genauen Sperrfristen regelt die Hämotherapie-Richtlinie.
Zeitweise ausgeschlossen sind:
- Personen, die durch ihr Sexualverhalten ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten haben. Sie sind für zwölf Monate nach dem letzten Sexualverkehr ausgeschlossen (Männer, die Sex mit Männern haben, Personen mit häufig wechselnden Sexpartnern, Sexarbeiter, transsexuelle Personen mit Risikoverhalten)
- Personen, die eine Operation hatten. Sie sind wenige bis mehrere Wochen ausgeschlossen. Auch eine Zahnziehung erfordert eine Woche Pause.
- Personen, die einen kosmetischen Eingriff hatten. Sie sind für vier Monate ausgeschlossen (Tätowierungen, Piercings, Ohrringe, Implantate etc.). Die Wunden der Nadelstiche können sich entzünden und eine Infektion auslösen.
- Personen, die in Risikogebieten für Infektionen (zum Beispiel Malaria, Zika-Virus, West-Nil-Virus) waren. Sie sind für vier Wochen ausgeschlossen.
Dauerhaft ausgeschlossen sind:
- Personen mit schweren Vorerkrankungen (Herz- und Gefäßkrankheiten, relevante Blutgerinnungsstörungen, Erkrankungen des Zentralnervensystems, Diabetes mit Insulin-Behandlung, Tumorerkrankungen und andere chronische Erkrankungen von Niere, Lunge oder Verdauungssystem, Störung des Immunsystems)
- Personen mit akuten Infektionskrankheiten (darunter HIV, Hepatitis-B, Hepatitis-C, Humanes T-lymphotropes Virus, Syphilis, Malaria, Tuberkulose, Salmonella) oder spongiformer Enzephalopathien (TSE)
Spender müssen den Blutverlust wegstecken
Auch Kranke oder Schwangere werden von der Blutspende ausgeschlossen. Ihr Körper verkraftet es nicht, wenn ihnen schlagartig 500 Milliliter Vollblut abgepumpt werden. Nach einer Erkältung, einem Schnupfen oder Husten wird eine Woche Auskurieren empfohlen, bevor Blut gespendet wird. Bei Fieber oder Durchfall mindestens vier Wochen. Bei Medikamenteneinnahme oder Impfung muss im Einzelfall beurteilt werden, ob eine Blutspende für den Spender risikofrei ist.
Weitere Angaben zum Artikel:
Was passiert mit dem Blut einer Spende?
- Aus dem Blutplasma werden vor allem Medikamente hergestellt, etwa für die Krebstherapie. Das Eiweiß im Plasma hilft Menschen mit schweren Verbrennungen oder Verletzungen.
- Rote Blutkörperchen bekommen Patienten mit hohem Blutverlust, damit die Körperzellen versorgt werden können.
- Blutplättchen helfen Patienten bei der Blutgerinnung. Sie müssen innerhalb von vier Tagen an den Empfänger übertragen werden.
Weiße Blutkörperchen werden aus der Probe entfernt.
Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:
Darum müssen wir drüber sprechen:
Blutspenden werden nicht gemacht, die unter Umständen gebraucht werden
Dabei ist es wichtig, dass Spenden aller Blutgruppen in den Krankenhäusern verfügbar sind, damit alle Patientinnen und Patienten schnell und gut versorgt werden können. Besonders wertvoll und gefragt sind Spenden der Blutgruppe Null. Sie können bei jedem Patienten eingesetzt werden und somit Leben retten in Situationen, in denen eine Bluttransfusion schnell vollzogen werden muss und keine Zeit bleibt, die Blutgruppe abzugleichen – zum Beispiel bei Unfallopfern, die zu verbluten drohen. Außerdem sind Menschen mit der Blutgruppe 0 auf Blutspenden der Gruppe 0 angewiesen. Sie sind die einzigen, die keine andere Blutgruppe als die eigene vertragen.
Weitere Angaben zum Artikel:
Welche Blutgruppen werden für eine Bluttransfusion gebraucht?
Blutgruppe A: die häufigste. Blutkonserven der Gruppe A können für Patienten mit Blutgruppe A oder AB benutzt werden. Etwa 43 Prozent der deutschen Bevölkerung hat A.
Blutgruppe B: eher selten. Blutkonserven der Gruppe B eignen sich nur für Patienten mit Blutgruppe B oder AB. Nur 11 Prozent haben Blutgruppe B.
Blutgruppe AB: seltene Allrounder. Bei Patienten dieser Blutgruppe können Konserven aller Blutgruppen benutzt werden. Allerdings haben nur 5 Prozent diese Blutgruppe.
Blutgruppe 0: der Joker bei Bluttransfusionen. Bei Notfällen sind Konserven der Gruppe 0 besonders hilfreich. Sie können bei Menschen aller Blutgruppen genutzt werden. Blutgruppe 0 haben etwa 41 Prozent der Bevölkerung.
Artikel Abschnitt:
Es gibt viele Menschen, die gerne Blut spenden würden – es aber nicht dürfen
Vor allem homosexuelle Männer fühlen sich diskriminiert, weil ihr Blut nicht gewollt ist. Sie dürfen laut offizieller Regelung nur dann Blut spenden, wenn sie mindestens zwölf Monate keinen Sex hatten. Der Schwulen- und Lesben-Verband etwa ist eine von vielen Institutionen, die gegen diese wahrgenommene Diskriminierung kämpft. Seit Jahren gibt es eine hitzige Debatte, ob die pauschale Ausschließung homosexueller, sexuell aktiver Männer bei der Blutspende gerechtfertigt ist.
Das Robert-Koch-Institut argumentierte bisher damit, dass sie deutlich häufiger an HIV erkranken als Heterosexuelle. Fragwürdig ist, inwiefern diese Begründung heute noch gilt.
Das HIV-Risiko hängt vom Verhalten ab, nicht von der sexuellen Orientierung
Bei heterosexuellen Personen wird bei der Blutspende-Zulassung unterschieden: Wer nur einen Sexpartner hat, darf spenden. Wer häufig wechselt, wird ausgeschlossen. Wieso gilt diese Regel nicht auch bei Transsexuellen oder homosexuellen Männern?
Die Begründung der Behörden lautet: Homosexuelle Männer erkranken statistisch gesehen häufiger an HIV als heterosexuelle Personen. Umgerechnet auf absolute Zahlen ist es aber immer noch ein sehr geringes Risiko: Von etwa vier Millionen homosexuellen Männern in Deutschland infizieren sich jedes Jahr 1.600 mit HIV. Das entspricht weniger als 0,04 Prozent. Zum Vergleich: Der Anteil der heterosexuellen Personen, die sich mit HIV infizieren, liegt im Bereich von 0,0007 Prozent.
Ärzte müssen auf Angaben des Spenders vertrauen
In den Blutspendezentren reichen die Kapazitäten nicht aus, um die Angaben der Spender zu überprüfen. Ärzte müssen darauf vertrauen, dass jeder den Fragebogen korrekt ausfüllt. Bei Vorerkrankungen und Reiseauskünften ist das nach Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts kein Problem. Bei den Angaben zum Sexualverhalten sind die Expertinnen und Experten eher skeptisch.
Vor allem bei homosexuellen Männer bestehe ein erhöhtes Risiko, dass sie eine HIV-Infektion haben, ohne es zu wissen. Einfach, weil sie statistisch gesehen häufiger ihre Sexpartner wechseln. Es besteht der Vorwurf, dass sie seltener über das Sexleben ihrer Partner Bescheid wissen. Aber noch mal zur Erinnerung: Nur 0,04 Prozent der Homosexuellen erkranken jedes Jahr überhaupt an HIV. Der Anteil der Betroffenen, der nichts von der Ansteckung weiß, ist also noch mal geringer.
Der pauschale Ausschluss von Männern, die Sex mit Männern hatten, soll auch bewirken, dass die Angaben in den Spenderbögen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig sind. Dabei kann genau das auch dazu verleiten, falsche Angaben zu machen. Zum Beispiel, wenn homosexuelle Männer trotzdem zur Blutspende gehen und verschweigen, dass sie schwul sind.
Weitere Angaben zum Artikel:
So wird sichergestellt, dass eine Blutspende kein Risiko für den Empfänger darstellt
- Spenderfragebogen: Gesundheitszustand (zum Beispiel Vorerkrankungen, Allergien), Operationen, Sexualverhalten und Reisetätigkeiten werden abgefragt.
- Gesundheitscheck des Spenders: Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Hämoglobinwerte werden überprüft. Sind die Werte in Ordnung, darf er/sie spenden.
- Untersuchung der Blutprobe: Im Labor wird das Blut auf Infektionskrankheiten untersucht.
Vertraulicher Selbstausschluss: Nach der Blutabnahme muss der Spender noch mal zustimmen, dass sein Blut verwendet werden darf. Ist er sich doch unsicher, kann er seine Spende anonym zurückziehen, indem er der Verwendung widerspricht.
Artikel Abschnitt: Aber:
Aber:
Manche Blutproben sind eine Gefahr für Patienten
Es gibt einen Zeitraum, in dem eine Infektion im Spenderblut nicht im Labor nachgewiesen werden kann: das diagnostische Fenster.
Ein Beispiel: Nach einer HIV-Ansteckung dauert es bis zu acht Wochen, bis das Immunsystem Antikörper bildet, die im Labor nachgewiesen werden können. Geht ein Infizierter innerhalb des diagnostischen Fensters zur Blutspende, kann es passieren, dass die Angaben im Spenderbogen und die Laboruntersuchungen der Blutproben unauffällig sind. Die Deutsche Aidshilfe schreibt, dass es sechs Wochen bis drei Monate nach Ansteckung dauern kann, bis eine HIV-Infektion sicher ausgeschlossen werden kann.
Genau deshalb werden Menschen, die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion und somit Erreger im Blut haben, für bestimmte Zeiträume von der Blutspende ausgeschlossen. Und zwar so lange, bis man mit hoher Sicherheit eine Fehldiagnose durch das diagnostische Fenster ausschließen kann.
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Blutspende-Regeln zeitgemäß anpassen
Für eine Prüfung der Angaben im Spenderbogen fehlen die Kapazitäten und “die Nachweistests sind heutzutage hoch spezifisch – da muss nichts verbessert werden”, sagt Susanne Stöcker, Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts.
Andere Länder erlauben drei statt zwölf Monate
Im Zuge der Corona-Pandemie hat schon die U. S. Food and Drug Administration (FDA) ihre Empfehlungen für die Richtlinien zeitweise geändert: Für Männer, die Sex mit Männern hatten, Tätowierte oder gepiercte Personen wurde die empfohlene Sperrfrist von zwölf auf drei Monate verkürzt. Grund dafür sind diesmal keine neuen Daten, sondern der dringende Bedarf an Blutkonserven für Patientinnen und Patienten.
Die Sperrfrist von “nur” drei Monaten ist nicht ungewöhnlich: In Kanada und Großbritannien galt sie schon vor der Pandemie. In Frankreich liegt sie bei vier Monaten. Eine Modellierung französischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Infektionsrisiko für Empfänger der Blutkonserven dadurch nicht signifikant verändert. Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass das stimmen könnte.
Nun soll auch in Deutschland Bewegung in die Sache kommen: Laut Medienberichten soll ein Fachgremium, in dem Experten des Paul-Ehrlich-Instituts, des Robert-Koch-Instituts und der Bundesärztekammer (BÄK) sitzen, sich darauf verständigt haben, dass die Blutspenderegeln für Homosexuelle in Deutschland gelockert werden könnten.
Das Gremium schlägt demnach vor, dass alle Menschen Blut spenden dürfen sollen, die seit mindestens vier Monaten fest mit jemandem zusammen sind und ausschließlich in der Partnerschaft sexuell aktiv sind. Spätestens nach diesem Zeitraum könnten Infektionen mit Hepatitis-Viren sowie dem HIV-Virus sicher ausgeschlossen werden. Die Frist soll dann für jedes Paar gelten. Egal welchen Geschlechts.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:



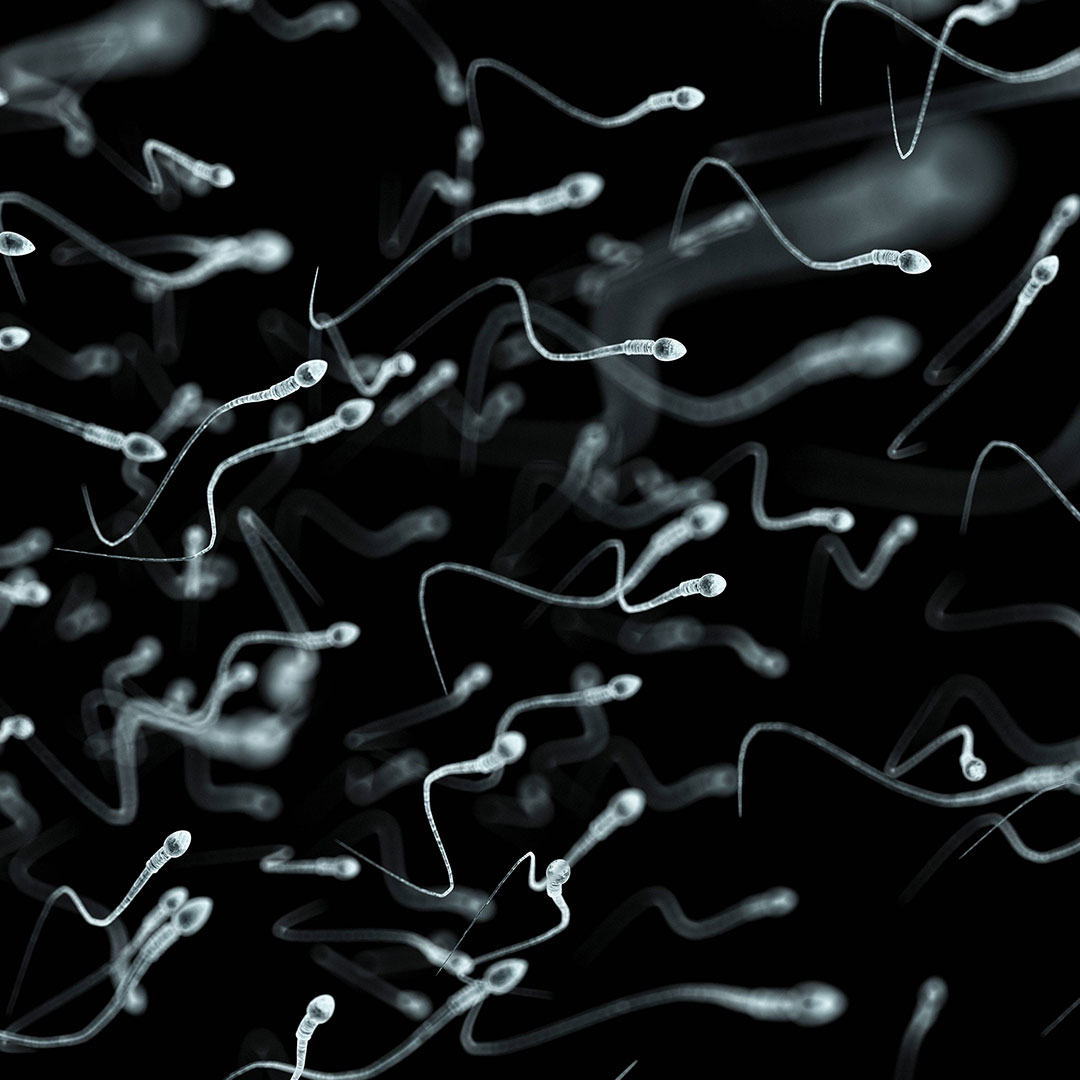


Mögt ihr den Artikel vielleicht mal aktualisieren? 2023 sind einige gesetzliche Änderungen umgesetzt worden, was Alter und sexuelles Risikoverhalten angeht.
Vielen Dank für den Hinweis, wir schauen uns das an.
Außerdem werden Menschen, die z.B. wenig Deutsch sprechen (aber hervorragend Englisch) ausgeschlossen, da die Fragebögen nur auf Deutsch vorhanden sind und die ärztlichen Vorgespräche nur auf Deutsch angeboten werden. Gerade in Großstädten mit vielen internationalen Einwohnern gehen so sehr viele potenzielle Spenden verloren.
Eine Personengruppe, die ausgeschlossen wird, fehlt: Unfallopfer! Weil ich als Kind nach einem Unfall gut zwei Liter Spenderblut bekommen habe, wurde ich vom BRK gebeten, nicht wiederzukommen. Das Risiko wäre zu hoch, dass ich mich dabei mit irgendwas infiziert hätte. Bitte?! Das hätte ich bestimmt in den letzten 20 Jahren… Weiterlesen »
Auch wer aktuell (vielleicht nur bestimmte) Medikamente nimmt ist von der Blutspende ausgeschlossen (fehlt in der Auflistung oben). Im Grunde sagt die erste Regel oben ja schon, dass jeder mit sexuellem Risiko-Verhalten ausgeschlossen ist (=mehrere wechselnde Partner). Warum werden dann Transsexuelle nochmal extra benannt? Wieso es bei Männern, die Sex… Weiterlesen »
Man darf auch kein Blut spenden, wenn man vor 30 (!!!) Jahren längere Zeit in Großbritannien gelebt hat …