Artikel Kopfzeile:
Great Barrington Erklärung
Darum ist der alleinige Schutz von Risikogruppen so schwer
Risikogruppen schützen und alle anderen normal leben lassen? Was gut gemeint klingt, ist in der Praxis aber kaum vertretbar und selten durchdacht.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Darum geht’s
Darum geht’s
Die Alten schützen, die Jungen normal leben lassen – geht das?
Die Initiative fordert einen verstärkten Fokus auf Risikogruppen. Sie sollen geschützt werden, während die übrige Gesellschaft ihr normales Leben fortführt, da SARS-CoV-2 für sie kein besonderes Risiko darstelle.
Das klingt erst einmal plausibel, die Umsetzung ist aus mehreren Gründen umstritten, sowohl was Weg als auch Ziel angeht. Zuerst einmal gilt angesichts der Barrington Erklärung aber: Ohne Maßnahmen kommt auch sie nicht aus.
Artikel Abschnitt: Deshalb müssen wir darüber sprechen
Deshalb müssen wir darüber sprechen
Das Risiko ist tatsächlich extrem ungleich verteilt
Aktuelle veröffentlichte oder vorläufige Studien sprechen von einem tausendfach höheren Risiko für Menschen über 80 Jahren im Vergleich zu Menschen jünger als 20 Jahre. Insofern ist es naheliegend, über den Schutz von Risikogruppen nachzudenken – um Intensivkapazitäten in Krankenhäusern zu schonen und zu verhindern, dass Menschen sterben.
Dieser Schutz ist übrigens keine neue Diskussion, sondern auch Teil der bisherigen Strategie. Die schwierige Frage ist jedoch, wie man diesen Schutz gestalten und erreichen will.
Die Forderungen der "Great Barrington Declaration“ sind unter anderem:
- vermehrte Kontrolle von Alters- und Pflegeheimen
- weniger Personalwechsel im Heim
- verstärkte PCR-Tests
- Einsatz von Impfstoffen
- Lebensmittel-Lieferungen nach Hause für alte Menschen
- Persönliche und familiäre Treffen draußen statt drinnen
- Kein Ausschluss von Risikogruppen vom sozialen Alltag und kulturellen Angeboten
Artikel Abschnitt: Aber
Aber
Risikogruppen zu schützen endet oft in Isolation
Warum Herdenimmunität für Corona illusorisch ist, erklären wir hier.
Die Deutsche Gesellschaft für Virologie hat im Oktober erneut davor gewarnt. Das Problem, wenn sich auch vorerst nur jüngere Personen infizieren:
- Es gibt asymptomatische Träger, die das Virus verbreiten
- Mit der Zahl an ("ungefährlichen“) Neuinfektionen steigt die grundsätzliche Ausbreitung
- Höhere und diffusere Infektionsgeschehen erschweren die Kontaktverfolgung
- Unkontrollierbare Infektionsketten gefährden letztendlich auch vulnerable Gruppen
- Viele Infektionen in Risikogruppen führen zu mehr Hospitalisierungen, zu mehr Todesfällen und möglicherweise zur Überbelastung des Gesundheitssystems
In den Sommermonaten zeigt die Altersstruktur der positiven Tests (über ganz Europa), dass sich vor allem jüngere Menschen infiziert haben. Die Zahl bei Menschen über 60, 70 oder 80 blieb über diesen Zeitraum sehr niedrig.
Irgendwann infizieren sich auch vulnerable Gruppen
In Deutschland zeigt sich seit der Kalenderwoche 36, also seit Ende August, dass sich auch wieder ältere Menschen angesteckt haben – in anderen europäischen Ländern ist das früher geschehen.
Ab dann folgt im Grunde ein recht striktes Schema: Wenn sich ältere Menschen infizieren, landet ein Teil davon auf den Intensivstationen und muss beatmet werden. Davon wiederum verstirbt etwa die Hälfte.
Trotz aller Erkenntnisse und Maßnahmen seit der Ausbreitung im Frühjahr haben es die Länder nicht geschafft, die Infektionen von Risikogruppen fernzuhalten. Sollten sich große Bevölkerungsteile nach der geforderten Strategie (Herdenimmunität) sogar mehr oder weniger absichtlich oder zumindest ohne Gegenmaßnahmen infizieren, ist das Alltagsrisiko für vulnerable Gruppen umso höher.
Wer geschützt werden soll, bleibt oft unklar
Unklar ist häufig auch, über welche Personengruppe man überhaupt spricht: Wie definiert man Risikogruppen? Das RKI nennt ein Alter ab 50 Jahren, diverse Vorerkrankungen oder auch das männliche Geschlecht als irgendwie risikobehaftet.
So oder so sind damit 20 bis 40 Millionen Menschen betroffen. Es ist schwer, eine Grenze zu ziehen. Ab wann wollen wir diese Menschen schützen? Wenn sie ein ein-, fünf- oder zehnprozentiges Infektionssterberisiko haben?
Darauf gibt es keine endgültige Antwort. Mit der Forschung nimmt das Wissen zu und es ändert sich die Risikoeinschätzung für bestimmte Gruppen – und politisch müsste man so eine willkürliche Grenze ziehen.
Übrigens: Ein statistisch niedriges Sterberisiko bedeutet nicht, dass mit einer Covid-19-Erkrankung nicht auch bei anderen Personen schwerwiegende oder längerfristige Nebenwirkungen einhergehen. Es mehren sich bislang die Hinweise, doch der bisherige Beobachtungszeitraum ist kurz.
Alters- und Pflegeheime haben sich abgeschottet
Die Diskussion um Pflege- und Altersheime findet schon seit Beginn der Pandemie statt. Gibt es dort Ausbrüche, führt das überdurchschnittlich oft zu Todesfällen. In Deutschland sind ein Drittel aller Todesfälle auf Infektionen in solchen Einrichtungen zurückzuführen.
Den Schutz zu verbessern würde also viele Todesfälle verhindern können. Im Frühjahr wussten viele Heime nicht, wie sie das Virus fernhalten sollten und haben sich die die Bewohner völlig abgeschottet.
Insgesamt betrifft das bis zu 820.000 Bewohner in Deutschland. Hinzu kommen bis zu 800.000 Menschen, die ambulant gepflegt werden. Eine vollständige Isolation würde diese Menschen vielleicht vor dem Virus schützen, allerdings ist gerade diese Gruppe besonders auf Nähe und die wenigen Kontakte angewiesen.
Artikel Abschnitt: Und jetzt?
Und jetzt?
Idee ist unrealistisch, Schnelltests können helfen
Die Forderungen nach Herdenimmunität und der implizierten Isolation von Millionen von Menschen selten durchdacht dafür oft populistisch. So wird die gesamte (Eigen-)Verantwortung auf sowieso benachteiligte Personen verlagert.
Schnelltests sind ein erster Schritt, um Abschottung zu verhindern
Eine aktuelle Maßnahme sind die neu zugelassenen Schnelltests. Seit Oktober sind sie offizieller Teil der nationalen Teststrategie auf das Coronavirus. Mit ihnen sollen Infektionen und Infektionsketten Einrichtungen mit besonders vulnerablen Personen möglichst rasch unterbrochen werden.
Wie die unterschiedlichen Tests funktionieren, erklären wir hier.
Mit den Schnelltests können unter anderem relevante Einrichtungen:
- … häufiger und regelmäßig Stichprobenanalysen bei Bewohnern, Personal und Besuchern durchführen
- … in Verdachtsfällen schneller Infektionen bei Kontaktpersonen ausschließen und Infektionsketten unterbrechen
- … in Gebieten mit hohen Fallzahlen vorsorglich Besucher testen, um eine vollständige Isolation verhindern
- … Pflegepersonal umgehend testen, ohne sie für die Wartezeit auf PCR-Testergebnisse in Quarantäne zu schicken
- … dringende Notfälle testen
Allerdings: Die Schnelltests ersetzen keine Diagnose durch einen PCR-Test und negative Ergebnisse gelten nicht als "Freifahrtschein“. Hygiene- und Mundschutzmaßnahmen gelten auch weiterhin.
Andere Wirtschaftsbereiche müssen warten
Solange die Kapazitäten von Schnelltests begrenzt sind, sieht die neue Testverordnung eine Priorisierung für Risikogruppen vor. Erst in den kommenden Monaten könnten Schnelltests auch andere Teile der gesellschaftlichen Bereiche wiederbeleben, die derzeit eingeschränkt oder untersagt sind oder wo Schnelltests relevante Infektionsketten unterbrechen können. Tests in Schulen stehen genauso in der Diskussion wie Schnelltests vor oder für Veranstaltungen.
In ausreichender Menge verfügbar und mit einem schlüssigen Konzept können sie richtig eingesetzt mehr Sicherheit vermitteln und weitere Teil des Alltags und der Normalität zurückholen – ohne einzelne Teile der Gesellschaft auszugrenzen.
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:



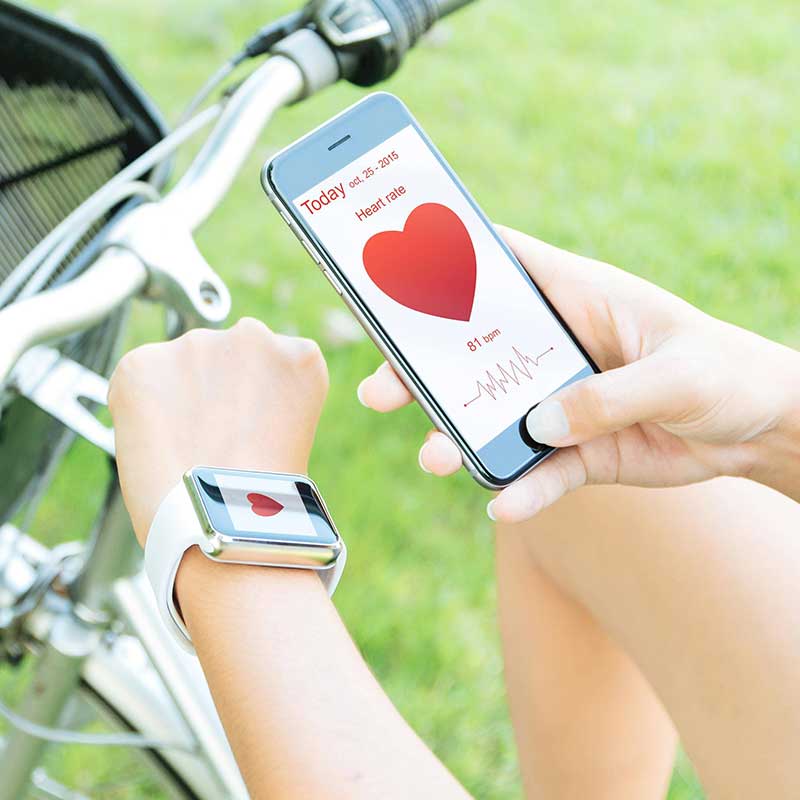


Schon krass, dass sich 100 Medizinprofessoren anmaßen einem „Wissenschaftsjournalist mit Schwerpunkt Digital und Film.“ zu widersprechen…
Über welche Expertise verfügt der Autor ?
Es erscheint mir reichlich vermessen, sich über die Autoren und das Heer der Unterzeichner, insbesondere der Wissenschaftler mit eigenen Argumenten hinwegzusetzen und die eigene Wahrheit als das Maß der Dinge darzustellen.
vulnerabel = verletzlich, störanfällig, gefährdet
Was ist denn nun mit der „unrealistischen Herdenimmunität“? Weil die Immunität vermutlich nur begrenzt anhält?
Vulnerabel – verwundbar! Vulnerabel ist die junge Generation. Zig Hundertausende von ihnen verwunden wir sehr langfristig, wenn nicht gar für den Rest ihrer Lebensjahrzehnte, die noch vor ihnen liegen. Nicht gut.