Artikel Kopfzeile:
Langzeitfolgen
So häufig ist Long Covid nach einer Coronainfektion
Nach zwei Wochen ist eine Coronainfektion meist vorbei. Doch viele klagen auch nach Monaten über starke Erschöpfung, Kopfschmerz, Geschmacksverlust und werden nie wieder fit.
Sprungmarken des Artikels:
Artikel Abschnitt: Was ist Long Covid?
Was ist Long Covid?
So spricht man in der Forschung von Long Covid, wenn bis zu zwölf Wochen nach der Coronainfektion noch Symptome bestehen. Man könnte es so verstehen, dass der Körper die akute Infektion noch etwas länger bekämpfen muss.
Alles ab drei Monaten wird eigentlich – zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – Post-Covid-Syndrom genannt. Betroffene haben zum Teil so starke Beschwerden, dass sie nicht mehr in ihren gewohnten, ursprünglichen Alltag zurückkommen und beispielsweise nicht mehr so viel oder gar nicht mehr arbeiten können.
Wir meinen hier im Weiteren aber mit Long Covid auch solche Fälle, die tatsächlich länger als drei Monate nach der Infektion noch Beschwerden haben, weil der Begriff geläufiger ist.
Artikel Abschnitt: Wie häufig ist Long Covid?
Wie häufig ist Long Covid?
Manchmal heißt es dann, das alles sei am Ende nur psychosomatisch oder aber nicht auf die Infektion, sondern zum Beispiel den Lockdown zurückzuführen. Das konnten Kohortenstudien widerlegen, die definitiv häufiger Symptome bei Infizierten sehen. Kohortenstudien beobachten unterschiedliche Gruppen von Proband:innen über einen längeren Zeitraum in Hinblick auf das Auftreten bestimmter Symptome und Krankheiten. So können sie zum Beispiel untersuchen, wie sich die Gesundheit von Infizierten und Nichtinfizierten unterscheidet.
Entscheidend ist bei der Häufigkeit von Long Covid nicht zuletzt mit welcher Corona-Variante man sich infiziert.
Kohortenstudien zufolge führten die Varianten vor Omikron bei circa zehn Prozent der Infizierten zu Long Covid mit Beschwerden, die über drei Monate andauern. Etwa die Hälfte ist so stark eingeschränkt, dass der gewohnte Alltag und das normale Arbeitspensum unmöglich sind.
Auf die Delta-Variante, die zwischen Juli und Dezember 2021 in Deutschland dominant war, folgte Omikron. Hier zeigt sich ein etwas besseres Bild: In einer Fall-Kontroll-Studie aus Großbritannien bekamen 4,5 Prozent der Omikron-Infizierten Long Covid – weniger als die Hälfte der Delta-Infizierten (10,8 Prozent). Allerdings ist noch nicht bekannt, ob sich die Subvariante BA.5, die derzeit in Deutschland dominant ist, anders verhält als bisherige Subtypen von Omikron.
Kinder sind seltener betroffen
Kinder und Jugendliche können ebenfalls von Long Covid betroffen sein. Beobachtungen zufolge erkranken dabei kleine Kinder deutlich seltener als Jugendliche. Die allermeisten erholen sich, aber einer Studie der Universität Zürich zufolge bleibt nach einer Coronainfektion ein niedriger einstelliger Prozentbereich an Kindern beeinträchtigt zurück. Ob sich diese Studie auf die derzeitige Omikron-Lage übertragen lässt, wird sich allerdings erst noch zeigen.
Bekannt sind die Spätfolgen auch bei anderen Viruserkrankungen: Nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus zum Beispiel, das verantwortlich für das Pfeiffer’schem Drüsenfieber ist, zeigten 13 Prozent der infizierten Kinder noch sechs Monate danach Symptome von ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronische Fatigue-Syndrom), einer multisystemischen Entzündung und chronischer Erschöpfung. Nach zwei Jahren hatte sich der Anteil um zwei Drittel reduziert, auf noch vier Prozent.
Weitere Angaben zum Artikel:
Wie man die Studienergebnisse richtig einordnet
- die Erhebungsmethode
- der Beobachtungszeitraum
- die Anzahl und Auswahl der Symptome
- die Anzahl der berichteten Symptome
- sowie Auswahl, Anzahl und Alter der untersuchten Patient:innen und Personen
berücksichtigt werden. Über Onlinebefragungen steigt die Fehlerquote, ohne Kontrollgruppe lassen sich Häufungen nicht seriös berechnen und wenn unbekannt ist, wer schon infiziert war, sind Fehlschlüsse quasi vorprogrammiert.
Artikel Abschnitt:
Nach der Infektion lassen viele Symptome wieder nach
Grundsätzlich können die Symptome und Beschwerden mit der Zeit nachlassen – sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Allerdings kommt das auch stark auf die Symptome an. Der Geschmacks- und Geruchsverlust ist in vielen Fällen reversibel und lässt sich wieder trainieren. Belastungsprobleme hingegen brauchen eine aufwendige und langwierige Therapie.
Ein Teil der schwer betroffenen Long-Covid-Patient:innen wird auf absehbare Zeit nicht mehr gesund werden.
Artikel Abschnitt: Wen trifft es?
Wen trifft es?
Auch nach milden und moderaten Fällen ist Long Covid möglich. Selbst nach asymptomatischen Infektionen lässt sich das Risiko nicht ausschließen.
Der "Corona-ExpertInnenrat" der Bundesregierung stellt zwei wesentliche Gruppen von Long Covid-Betroffenen heraus:
- Ältere (über 60), häufig männliche Betroffene mit Folgeerkrankungen nach schwerem, teilweise intensivpflichtigem Verlauf
- Jüngere (unter 60), Patient:innen mit moderaten oder milden Verläufen ohne Krankenhausaufenthalt. Hier finden sich etwa doppelt so viele Frauen wie Männer.
In der wissenschaftlichen Literatur wird auch darüber spekuliert, ob vorherige Infektionen mit anderen Viren eine Rolle spielen und diese "schlafenden Viren" dann den Ausschlag geben. Wahrscheinlicher aber ist, dass das Coronavirus bei einigen Personen das Immunsystem umgeht, schwächt und Schäden anrichtet oder zu Störungen führt, die dann weiterbestehen.
Neue Varianten und viele offene Fragen
Die bisherige Datenlage bezieht sich insbesondere auf die frühen Infektionswellen in der Pandemie. Klar ist: Varianten, die häufiger schwere Verläufe provozieren, führen auch häufiger zu Long Covid – schließlich richten sie direkte Schäden im Körper an, die über längere Zeit heilen müssen. Hier gibt es bei der Omikron-Variante also etwas Entwarnung.
Allerdings haben sich mit den Mutationen in den verschiedenen Varianten auch Pathomechanismen verändert, also zum Beispiel die Art und Weise, wie gut und wie stark das Virus an Zellen bindet, in welche Zellen es eindringt und wie gut es sich in der kurzen Zeit vermehrt.
Immunfluchtvarianten wie Omikron BA.4 und BA.5 könnten das Bild von Long Covid also weiter verändern.
Artikel Abschnitt: Welche Symptome treten auf?
Welche Symptome treten auf?
Zu den häufigsten Symptomen zählen:
- starke Erschöpfung (58 Prozent)
- Kopfschmerzen (44 Prozent)
- Konzentrationsstörungen (27 Prozent)
- Haarverlust (25 Prozent)
- Atemnot (24 Prozent)
- Geruchs- (21 Prozent) und Geschmacksverlust (23 Prozent)
Die Symptome treten aber selten einzeln auf, sondern häufig in Kombination. In einer größeren Studie haben Forschende versucht, die häufigsten Kombinationen zu Long-Covid-Typen zusammenzufassen und dabei folgende Typen charakterisiert:
- grippeähnlich ohne Fieber: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Muskelschmerz, Husten, Halsschmerz, Brustschmerz, kein Fieber
- grippeähnlich mit Fieber: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Husten, Halsschmerz, Heiserkeit, Fieber, Appetitverlust
- gastrointestinal: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Appetitverlust, Durchfall, Halsschmerz, Brustschmerz, kein Husten
- schwer Level eins, Erschöpfung: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Husten, Fieber, Heiserkeit, Brustschmerz, Erschöpfung
- schwer Level zwei, Verwirrung: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Appetitverlust, Fieber, Heiserkeit, Halsschmerz, Brustschmerz, Verwirrung, Muskelschmerz
- schwer Level drei, abdominal und respiratorisch: Kopfschmerz, Geschmacks- und Geruchsverlust, Appetitverlust, Husten, Fieber, Heiserkeit, Halsschmerz, Brustschmerz, Erschöpfung, Verwirrung, Muskelschmerz, Kurzatmigkeit, Durchfall, Bauchschmerz
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden aber nur wenige Klassifizierungen dem einzelnen Patienten/der einzelnen Patientin gerecht, denn die Kombination von Symptomen ist sehr individuell.
Bei den neuen Omikron-Subvarianten scheinen zudem der Geruchs- und Geschmacksverlust kaum eine Rolle zu spielen.
Wesentliche Unterschiede gibt es zwischen den beiden genannten Gruppen – schwerer Verlauf und milder/asymptomatischer Verlauf: Bei der ersten Gruppe lassen sich die Symptome oft besser nachweisen, etwa, wenn das Virus Zellen in den Bronchien zerstört und starke Entzündungen entstehen. Bei der anderen Gruppe ist es schwieriger – dazu gleich mehr.
Einige Symptome lassen sich immerhin messen. Bei chronischer Erschöpfung etwa können Handkraftmessungen zeigen, dass die Muskelkraft bei Long-Covid-Patient:innen deutlich schneller nachlässt.
Messbare Symptome helfen Patient:innen
Bei einigen Patient:innen steigt beim Aufstehen der Puls binnen Minuten an, es kommen Benommenheit und Schwindel hinzu, bis sie sich wieder hinlegen. Dabei handelt es sich um das sogenannte posturale Tachykardiesyndrom (POTS). Auch das ist für Ärztinnen und Ärzte mit dem Schellong-Test relativ leicht messbar.
Durchblutungsstörungen versuchen Ärzte an kleinen Gefäßen in den Augen festzustellen. Dort lassen sich kleine Blutgerinnsel messen. Doch solche Diagnostik gibt es nicht für alle Symptome und nicht jeder Arzt und jede Ärztin kennt diese Methoden. Das kann dazu führen, dass Betroffene mit ihren Leiden nicht ernst genommen werden oder nicht die bestmögliche Therapie bekommen.
Artikel Abschnitt: Welche Prognose haben Betroffene?
Welche Prognose haben Betroffene?
Gerechnet auf die Schätzungen zur Häufigkeit von Long Covid ergibt das etwa fünf Prozent aller Infektionen, die schwer beeinträchtigt sind und zwei Prozent, die ihrer Arbeit gar nicht mehr nachkommen können und auch an vielen für die meisten Menschen trivialen Alltagstätigkeiten scheitern.
Eine im Juli 2022 vorgestellte Untersuchung der Techniker Krankenkasse zeigt anhand von Versichertendaten, dass Long Covid-Betroffene mit leichtem Verlauf im Jahr 2021 durchschnittlich 90 Tage krankgeschrieben waren. 190 Tage waren es bei Betroffenen, die aufgrund von schweren Verläufen beatmet werden mussten.
Einige Patient:innen werden nicht mehr gesund
In welchen Fällen die Long-Covid-Symptome wieder weggehen und bei wem sie bleiben, lässt sich noch nicht beantworten. Eine Studie gibt jedoch eine erste Einschätzung zur Prognose von Long-Covid-Patient:innen, die bereits fünf Monate an Symptomen leiden. Dort ließen die meisten untersuchten Symptome zwischen fünf und zwölf Monaten kaum nach. Sie waren weiterhin erschöpft, mitunter sogar stärker als zuvor, und berichteten von einer erheblich eingeschränkten Lebensqualität. Mehr als ein Fünftel aller Patient:innen war auch nach einem Jahr betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome von allein verschwinden, sinkt mit der Zeit demnach drastisch.
Ähnlich wie Patient:innen mit Myalgischer Enzephalomyelitis/dem Chronischen Fatique-Syndrom (ME/CFS) wird auch ein Teil der Long- Covid-Patient:innen nicht mehr gesund, solange kein Medikament wirklich Heilung versprechen kann.
Weitere Angaben zum Artikel:
Ist das nur bei SARS-CoV-2 so?
Gehirnhautentzündungen entstehen etwa auch durch Enteroviren. Unterschieden werden müssen aber Schäden, die das Virus in der akuten Phase der Erkrankung anrichtet, und die speziellen Beschwerden, die bei Long Covid denen von ME/CFS ähneln.
Artikel Abschnitt: Was sind die Ursachen?
Was sind die Ursachen?
Plötzlich bekämpft der Körper sich selbst
Noch ist nicht ganz klar, was genau zu Long Covid führt. Drei ursächliche Mechanismen werden jedoch besonders intensiv diskutiert. So ruft das Virus im Körper eine sehr starke Immunreaktion hervor. So stark, dass das Immunsystem auch gestört werden kann und sich die Antikörper nicht mehr gegen das Virus, sondern gegen die eigenen, gesunden Körperzellen richten – dann nennt man sie Autoantikörper. Sie spielen etwa bei Autoimmunkrankheiten eine Rolle.
Das würde einerseits die langanhaltenden Symptome erklären, und andererseits die Tatsache, dass Frauen häufiger betroffen sind: Fast alle Autoimmunerkrankungen treten bei Frauen häufiger auf. Die Hauptrollen spielen hier das X-Chromosom und das Östrogen.
Bei solchen dauerhaften Immunreaktionen herrscht unnatürlicherweise ständig Alarm im Körper. Das kann Signalwege des Nervensystems beeinträchtigen, etwa solche, die Atmung oder Herzschlag steuern.
Der Körper wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt
Ein anderer Erklärungsansatz zielt auf die Schäden in den Adern, genauer gesagt in der innersten Schicht der Adern. Während der Infektion führt das Coronavirus dort zu Schäden und die Entzündung bleibt womöglich auch nach der Infektion noch aktiv. Die Durchblutung in den kleinen Gefäßen ist gestört, es gibt Berichte über kleine Blutgerinnsel, also Minithrombosen in den Kapillaren.
Das beeinträchtigt die Sauerstoffversorgung, zum Beispiel der Muskeln und Organe. Das würde erklären, weshalb viele Betroffene nach körperlicher Anstrengung (und dazu zählen schon das Treppensteigen oder Anziehen) sich völlig erschöpft fühlen. Eine mangelhafte Sauerstoffversorgung des Gehirns könnte zusammen mit Störungen des Nervensystems auch so etwas wie Kopfschmerzen oder Verwirrung (häufig: "brain fog") oder Konzentrationsstörungen erklären.
Versteckt sich das Virus im Körper?
Eine andere These sieht die Ursache darin, dass Viruspartikel oder Virusreste noch weiterhin im Körper verbleiben und so das Immunsystem immer wieder oder langfristig reizen. Dafür spricht, dass Patient:innen auch Monate nach der Infektion noch positiv auf bestimmte Virusproteine getestet wurden, jedoch nicht mehr auf das Spike-Protein, das ansonsten als Infektionsnachweis gilt.
Verbleiben diese Proteine in Zellen oder Geweben, kann das zu einer andauernden oder immer wieder aufflammenden Entzündungsreaktion führen und könnte Nervenschäden oder Einschränkungen des Geruchs- oder Geschmackssinns erklären. Für andere Viren hat man diese Überbleibsel bereits nachgewiesen.
Letztlich wird vermutlich nicht einer der obigen Ansätze alle Fälle von Long Covid erklären. Dafür sind die Symptome und Krankheitsverläufe zu verschiedenen. Denkbar ist, dass alle drei Ursachen zutreffen könnten – allein oder in Kombination.
Artikel Abschnitt: Schützt die Impfung?
Schützt die Impfung?
Der Schutz vor Long Covid besteht also nur bei einer hohen Wirksamkeit der Impfstoffe. Diese nimmt aber mit der Zeit ab, weil das Immunsystem die Menge an Antikörpern mit der Zeit verringert und auf einen Energiesparmodus umschaltet.
Ebenso führen Mutationen bei neuen (Sub-)Varianten dazu, dass die Impfstoffe weniger wirksam sind; etwa bei den sich derzeit ausbreitenden Varianten BA.4 und BA5.
Was also, wenn man trotz Impfung erkrankt?
Die Studienlage ist unzureichend – und verwirrend. Einige ältere Studien deuten darauf hin, dass die Impfung das Risiko senkt – manche sprechen von einem halbierten Risiko, lang anhaltende Symptom bekommen zu können, manche von einer noch viel deutlicheren Risikosenkung. Es gibt aber auch Studien, die sehen keinen (guten) Schutz vor Long Covid.
In der derzeit größten Kohortenstudie zum Thema konnte der Schutz der Impfung vor Long Covid auf nur 15 Prozent beziffert werden. Und in dem Betrachtungszeitraum sind aktuelle Varianten noch gar nicht aufgeführt.
Hier zeigt sich erneut das Problem hochqualitativer Studien in einer Pandemie: Sie benötigen Zeit. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse hat sich die Pandemielage oft schon grundlegend verändert.
Artikel Abschnitt: Gibt es Therapien und Heilung?
Gibt es Therapien und Heilung?
Eine zentrale Therapie gibt es derzeit nicht, deshalb arbeitet man symptomorientiert.
Erste Anlaufstelle ist die Hausarztpraxis. Dort werden die Symptome erfasst und, wenn möglich, direkt behandelt. Komplexe oder schwere Krankheitsbilder werden an Fachabteilungen beziehungsweise Rehakliniken übergeben. Symptome können so gelindert oder geheilt werden. Ein paar Beispiele:
Bei Geschmacks- und Geruchsverlust gibt es spezielle Trainings, um die Sinne wieder zu trainieren und zu schärfen. Ein Teil der Patient:innen, bei denen der Geschmacks- und Geruchssinn nicht von alleine wiederkommt, erlangt so das alte Empfinden allmählich mühsam zurück.
Stellt man bei Patient:innen die mangelhafte Sauerstoffversorgung fest, so kann eine Sauerstoffüberdruckkammer einigen von ihnen helfen. Die Patient:innen atmen dort reinen Sauerstoff ein, die Zellen werden etwas besser mit Sauerstoff versorgt.
Kleine Blutgerinnsel oder mögliche Überbleibsel des Virus, die Blutgefäße verstopfen, lassen sich mit einer sogenannten H.E.L.P.-Apherese verbessern, bei der das Blut der Patient:innen gewaschen wird.
Ansonsten bleibt Patient:innen häufig nur, sich mit der neuen, niedrigen Leistungsfähigkeit vorerst zu arrangieren und das neue Körpertempo zu akzeptieren. Das fällt gerade Menschen schwer, die vorher sehr aktiv waren. Es ist für viele schädlich, gegen die Erschöpfung anzutrainieren. Danach fallen Betroffene nur in ein größeres Leistungsloch, weil der Körper die Belastung überhaupt nicht verkraften kann.
Kann die Impfung Long Covid heilen?
Expert:innen hatten gehofft, dass auch Corona-Impfstoffe Long-Covid-Patient:innen helfen könnten. Wenn zum Beispiel Virusreste für die Symptome verantwortlich wären, wäre es plausibel, dass die Impfung dem Immunsystem einen Schub gibt, mit dem auch die Reste erkannt und eliminiert werden könnten. Mittlerweile haben sich auch viele Menschen nach ihrer Corona-Infektion und trotz ihrer Long-Covid-Symptome impfen lassen.
Laut Prof. Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz der Berliner Charité, hilft eine nachträgliche Impfung bei Long Covid jedoch nur den Allerwenigsten. Hier müssen Medikamente her.
Hoffnungsschimmer: Forschung nach Medikamenten
Weltweit forschen Unternehmen und Universitäten nach Heilmitteln für Long-Covid-Patient:innen.
Der Fokus liegt vor allem auf den Autoantikörpern, die sich gegen den eigenen Körper richten. Diese müsste man eliminieren – beziehungsweise die B-Zellen, von denen sie produziert werden.
Ein vielversprechendes Forschungsprojekt findet derzeit in Erlangen statt: Beim Medikament "BC 007" handelt es sich ursprünglich um ein Herzmedikament, das nun bei Long-Covid-Patient:innen eingesetzt werden soll. Es setzt an diesen Autoantikörper an und könnte auch die Durchblutung der Gefäße wieder verbessern.
Noch sind aber viele Therapieansätze im Anfangsstadium und werden Jahre benötigen, um sich zu beweisen oder großflächig zum Einsatz zu kommen. Mehr Geld für die Forschung kann helfen, diesen Prozess zu beschleunigen und die Beschwerden bei Patient:innen zu lindern oder gar zu beseitigen — womöglich sogar bei ME/CFS-Patient:innen, die schon lange um Aufmerksamkeit kämpfen.
Autor: Mathias Tertilt & Shajan Ramezanian
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:


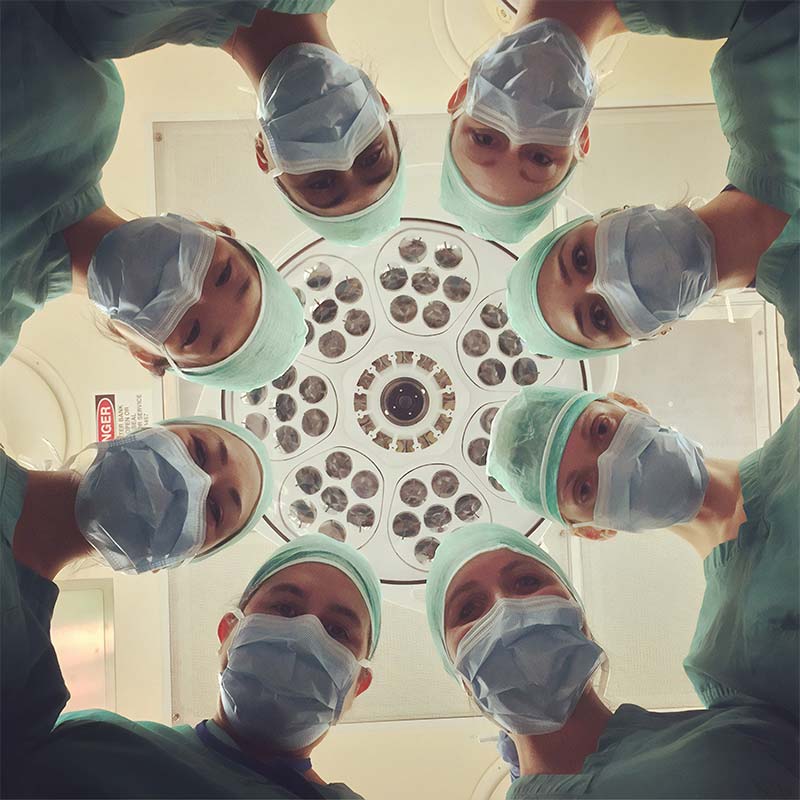



Das ist ein sehr informativer Artikel! Leider fehlt noch der Hinweis auf eine mögliche instabile Halswirbelsäule (CCI/AAI), die in seltenen Fällen durch Viruserkrankungen, wie auch Corona, ausgelöst werden kann und zu ME/CFS-Symptomen führt. Betroffene werden dementsprechend leider kontraporduktiv behandelt, was zu einer Verschlechterung der Symptome führt und einer Vernachlässigung der… Weiterlesen »
Die Impfung schützt NICHT vor Long-Covid. Der Artikel ist insofern unrichtig bzw. veraltet. Bitte um Update.
In dem Artikel werden die Aussagen gesammelt aufgezeigt, die entsprechend auseinandergehen. Für eine definitive Einschätzung ist die Studienlage noch unzureichend.
Ich glaube Long-Covid ist eine Impfnebenwirkung. Die beschriebenen Symptome sind teilweise exakt die selben wie sie meine Mutter nach der 2. Comirnaty-Spritze hat. Der Schwindel und die Muskelschmerzen in den Beinen steigerten sich sogar noch nach dem Booster, aber der Hausarzt verhöhnt sie und faselt von Frischluft- und Wassermangel, lächerlich.… Weiterlesen »
Wir haben auch einen Beitrag zu Long Covid nach der Impfung. https://www.quarks.de/gesundheit/gibt-es-long-covid-nach-der-impfung/
Ich hatte mich am 4.07.2022 mit Corona infiziert auf einer Fähre vom Urlaub nach Hause. Zwei Tage später hatte ich bereits über 39 Grad Fieber. Am 11.07.2022 ging ich wieder (remote) arbeiten und dachte, es sei ja nun vorbei. Allerdings habe ich bis heute (19.07.) immer noch den gleichen Husten… Weiterlesen »
vielen Dank für diesen Artikel! Ich finde mich endlich ein wenig wieder… Ich habe seit meiner Coronainfektion immer wieder erhöhte Temperatur/Brust- und Halsschmerzen/Schlafprobleme und einen nervösen Darm… Jedoch nicht die ganze Zeit! Es flammt immer wieder auf und dann gibts auch Tage, an denen es besser/gut ist! Könnten Sie mir… Weiterlesen »
Das können wir dir leider auch nicht beantworten – dass du bei deiner Ärztin warst, ist genau richtig. Sie soll dich am besten an einen Spezialisten überweisen. Es gibt inzwischen schon einige Long-Covid-Zentren in Deutschland.
Liebe Debora,
Ich habe exakt die selben Symptome seit April 2023. Darf ich Sie fragen, ob es bei Ihnen mittlerweile besser geworden ist bzw. was Sie unternommen haben? Mir kann kein Arzt weiterhelfen.
Liebe Grüße
Liebes Team von Quarks, diese Daten aus dem Artikel bezüglich Long Covid beziehen sich doch auf die ersten Varianten, bis hin zur Delta Variante von Covid oder? Diese Forschung musste ja auch erstmal stattfinden, denk ich mir. Es ist wahrscheinlich zu früh jetzt überhaupt Prognosen über die Omikron Variante anzustellen.… Weiterlesen »