Artikel Kopfzeile:
Abhängigkeit
Alles zum Thema Sucht
Eine Sucht kann sich schleichend entwickeln oder auch schnell die Kontrolle übernehmen. Was passiert dabei im Gehirn, warum wird man sie schlecht wieder los und was hilft?
Sprungmarken des Artikels:
Inhalt
- Was genau ist eine Sucht?
- Kann ich nach einem Verhalten süchtig werden?
- Wie entsteht eine Sucht?
- Wie sieht die Forschung zu Suchterkrankungen aus?
- Welche Rolle spielt Stress bei Suchterkrankungen?
- Warum ist es so schwer, eine Sucht loszuwerden?
- Warum werden manche Menschen eher süchtig als andere?
- Welche Rolle spielen andere psychische Erkrankungen bei der Drogensucht?
- Was kann gegen die Sucht helfen?
- Muss man für immer aufhören, um eine Sucht zu überwinden?
- Was genau ist eine Sucht?
- Kann ich nach einem Verhalten süchtig werden?
- Wie entsteht eine Sucht?
- Wie sieht die Forschung zu Suchterkrankungen aus?
- Welche Rolle spielt Stress bei Suchterkrankungen?
- Warum ist es so schwer, eine Sucht loszuwerden?
- Warum werden manche Menschen eher süchtig als andere?
- Welche Rolle spielen andere psychische Erkrankungen bei der Drogensucht?
- Was kann gegen die Sucht helfen?
- Muss man für immer aufhören, um eine Sucht zu überwinden?
Artikel Abschnitt: Was genau ist eine Sucht?
Was genau ist eine Sucht?
Diese Frage betrifft viele Menschen in Deutschland. Die am weitesten verbreitete Sucht ist der gesellschaftlich akzeptierte Alkohol: In der ambulanten und der stationären Suchtbehandlung werden die meisten Patientinnen und Patienten deswegen behandelt, gefolgt von Cannabis und Opioiden – also etwa Heroin.
Doch wann genau gilt jemand als drogensüchtig? Das hängt von verschiedenen Kriterien ab, die im Laufe der Jahre immer wieder angepasst werden. Im deutschen Gesundheitssystem richten wir uns nach der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD). Derzeit gilt noch die Version 10, ab Januar 2022 soll ICD-11 genutzt werden – beschlossen wurde sie bereits im Mai 2019 auf der 72. Weltgesundheitsversammlung.
Die ICD-11 sieht für Drogenabhängigkeit drei Kriterien vor. Treten zwei von ihnen über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten auf, gilt jemand als abhängig.
- Verminderte Kontrolle über den Konsum: Betroffene können nicht mehr selbst regulieren, wann und wie viel sie konsumieren, unter welchen Umständen oder wann sie aufhören. Oft wird das von einem starken Verlangen (Craving) begleitet, aber nicht immer.
- Steigende Priorität: Die Droge nimmt einen immer größeren Stellenwert im Leben ein, wodurch andere Dinge vernachlässigt werden. Soziale Kontakte, der Beruf, andere Verantwortungen, Hobbys und die Gesundheit treten in den Hintergrund. Obwohl dies zu Problemen führt, konsumieren die Betroffenen die Droge weiter.
- Physiologische Merkmale: Betroffene benötigen immer mehr von der Droge, weil sie eine Toleranz entwickeln. Fehlt der Nachschub, zeigen sich Entzugssymptome. So wird es immer wichtiger, die Droge einzunehmen, um die Symptome zu verhindern oder zu lindern.
In der Wissenschaft – und auch in den USA – wird zur Einordnung das "Diagnosehandbuch für psychische Störungen der American Psychiatric Association" (DSM-5) genutzt. Hier sind die Kriterien zwar ähnlich, aber in elf Merkmale aufgefächert.
Artikel Abschnitt: Kann ich nach einem Verhalten süchtig werden?
Kann ich nach einem Verhalten süchtig werden?
Auch Onlinespiele und andere Onlineaktivitäten können süchtig machen.
Es wird zudem immer deutlicher, dass auch übermäßiges Essen oder sogar Sport süchtig machen können.
Artikel Abschnitt: Wie entsteht eine Sucht?
Wie entsteht eine Sucht?
Es beginnt mit dem Trinken (Drogennutzung). Manche Menschen bleiben ihr Leben lang in diesem Stadium. Sie trinken manchmal etwas, können aber auch problemlos über längere Zeit darauf verzichten. Warum das so ist, besprechen wir hier.
Andere merken vielleicht, dass sie zu oft zu viel trinken und beschließen, erst mal eine Pause zu machen (Abstinenz). Dann kommt das Verlangen: "Ein Glas ab und zu kann doch nicht schaden, oder?“ Also beginnen sie wieder, Alkohol zu konsumieren (Rückfall). Diesmal trinken sie vielleicht mehr oder öfter als vorher – auch wenn sie es gar nicht wollen. Aufgeschreckt von dieser Erkenntnis beginnen sie die nächste Runde mit Abstinenz, Verlangen und Rückfall. So geht es immer weiter. Die Sucht vertieft sich mit jedem Zyklus, indem sie Prozesse im Gehirn verändert. So werden etwa neue Andockstellen für Botenstoffe gebildet oder die Botenstoffe selbst mehr oder weniger ausgeschüttet. Zudem bilden sich neue Verbindungen zwischen Nervenzellen, andere verkümmern.
Wie intensiv die verschiedenen Stadien sind und wie schnell eine Phase auf die nächste folgt, kommt auf die Substanz an.
Verschiedene Motivationen
Je öfter jemand den gesamten Zyklus durchläuft, desto zwanghafter wird die Motivation für den Drogenkonsum. Während der ersten Durchgänge des Zyklus geht es meistens noch um die angenehmen Effekte wie den Spaß bei einer Party, die Entspannung oder auch eine – kurzfristig – gesteigerte Leistungsfähigkeit. Das wird als impulsives Stadium bezeichnet, da die Betroffenen aus dem Impuls heraus die Droge nehmen.
"Aus der anfänglichen Belohnung wird allerdings irgendwann ein Zwang“, erklärt Dr. Mathias Luderer, Leiter der Suchtmedizin am Universitätsklinikum der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. "Man nimmt die Substanz nicht mehr ein, weil es Spaß macht, sondern weil es nicht mehr anders geht.“ Nun beginnt das zwanghafte – oder auch kompulsive – Stadium: Man braucht die Droge, um die Entzugssymptome wie etwa Zittern oder Schlafstörungen abzuwenden und das starke Verlangen zu lindern. Zudem haben Patientinnen und Patienten zu diesem Zeitpunkt immer weniger Kontrolle über ihren Konsum.
Zwei Netzwerke im Gehirn
Die verschiedenen Motivationen spiegeln sich auch im Gehirn wider. Anfangs aktiviert die Droge vor allem das Belohnungssystem. Wer es genauer wissen möchte: Dieses Netzwerk besteht vor allem zwischen dem Nucleus accumbens, dem präfrontalen Kortex und dem ventralen tegmentalen Areal. Entwickelt sich eine Sucht, verändern sich die Prozesse in diesem Netzwerk. So entsteht auch die Toleranz: Das Belohnungsnetzwerk gewöhnt sich sozusagen an den Nachschub und braucht beständig mehr von der Droge, um überhaupt zu reagieren.
Daran sind verschiedene Botenstoffe im Gehirn beteiligt – etwa Dopamin, Glutamat und GABA (Gamma-Aminobuttersäure) –, die entweder weniger auf die Substanz reagieren oder im Fall von GABA die Reaktion auf eine Droge schneller unterdrücken.
Gleichzeitig wird das Stresssystem immer aktiver. Die entscheidende Gehirnregion hierfür ist die Amygdala, wegen ihrer Form auch Mandelkern genannt. Sie interagiert mit dem Nucleus accumbens und dem präfrontalen Kortex und vermittelt Stress und negative Gefühle, wann immer die Droge fehlt.
"Allerdings können wir nicht pauschal sagen, dass Süchtige keine positiven Effekte der Droge mehr verspüren“, gibt Dr. Anita Hansson, Leiterin der Neuroanatomie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, zu bedenken. Die Patienten seien schlicht zu unterschiedlich. "Für manche Süchtigen mag das Belohnungssystem durchaus noch eine Rolle spielen. Wie genau diese aussieht, ist bisher unklar.“
Der Einfluss des Darms
Es wird in der Forschung immer deutlicher, dass bei psychischen Erkrankungen nicht nur das Gehirn, sondern auch der Darm von Bedeutung ist. Das gilt ebenso für Suchterkrankungen. Offenbar besteht ein Austausch zwischen den beiden Organen – das Gehirn beeinflusst das Mikrobiom (also die Bakterien) im Darm und umgekehrt. Und auch Drogen selbst können die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern. Gleichzeitig machen sie den Darm durchlässiger, was weitere Veränderungen mit sich bringt. Wenn Forschende mehr dazu herausfinden, könnte das für die Behandlung der Sucht hilfreich sein.
Artikel Abschnitt: Wie sieht die Forschung zu Suchterkrankungen aus?
Wie sieht die Forschung zu Suchterkrankungen aus?
Die Grundlagenforschung findet oft an Versuchstieren statt. Dazu haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Tiermodelle entwickelt, in denen zumeist Ratten oder Mäuse eine Droge zu sich nehmen können – je nach Modell werden sie von der Substanz abhängig gemacht. "Mit Tiermodellen lassen sich komplexe psychische Erkrankungen wie Sucht natürlich nicht vollständig darstellen“, sagt Anita Hansson. “Wir können uns mit ihrer Hilfe aber bestimmte Aspekte genauer ansehen, als es mit menschlichen Studienteilnehmenden oder Proben der Fall wäre.“
Ein Problem sieht Anita Hansson darin, dass in den meisten Studien eine einzige Droge untersucht wird. In der Realität seien aber viele Patientinnen und Patienten abhängig von mehreren Substanzen gleichzeitig – was Auswirkungen auf die Mechanismen und letztendlich auch auf die Behandlung haben kann. "Darüber wissen wir noch viel zu wenig“, so Hansson.
Dazu kommt, dass die meisten Studien Männer oder männliche Versuchstiere untersuchen. Die Erklärung ist recht einfach: Bei Frauen und weiblichen Tieren müssten die Forschenden den Hormonzyklus in ihre Auswertung einbeziehen. Das ist deutlich komplexer und manchmal auch aufgrund der Datenlage nicht möglich. Dabei wäre es wichtig, zu sehen, wie sich Männer und Frauen in Bezug auf Suchterkrankungen unterscheiden, schon um die optimale Behandlung für beide Geschlechter zu finden.
Dass oft nur an Männern oder männlichen Tieren geforscht wird, ist ein weitverbreitetes Problem, das wir auch in der Forschung zu anderen psychischen und physischen Erkrankungen finden. Sicher ist, dass es einen Unterschied im Suchtverhalten von Frauen und Männern gibt – nur welche Hormone und Gene dafür zusammenspielen, muss noch erforscht werden.
Artikel Abschnitt: Welche Rolle spielt Stress bei Suchterkrankungen?
Welche Rolle spielt Stress bei Suchterkrankungen?
Doch selbst wenn man es schafft, keine Drogen mehr zu nehmen, kann Stress die Pläne durchkreuzen. Denn er sorgt häufig dafür, dass die Patientinnen und Patienten rückfällig werden. Das liegt zum einen daran, dass Stress genau die Gehirnregion herunterfährt, die unsere rationalen Entscheidungen lenkt – den präfrontalen Kortex – und gleichzeitig das Striatum aktiviert, das uns impulsiver werden lässt.
Zum anderen unterstützt Stress einen weiteren Mechanismus, der selbst zu einem Rückfall führen kann: Patienten bringen bestimmte Reize mit den Drogen in Verbindung. Bei einer Alkoholsucht kann das etwa eine Flasche sein, der Geruch einer Bar oder auch nur ein Lied, das man in betrunkenem Zustand häufig gehört hat. Dieser Mechanismus heißt "Cue-induced Reinstatement“, also durch einen Reiz verursachte Wiederaufnahme des Drogenkonsums. Stress verstärkt diesen Rückfall noch, indem er die Aufmerksamkeit besonders auf die Reize lenkt.
Dazu kommt das sogenannte "Stress-induced Reinstatement“, bei dem allein der Stress ausreicht, um wieder in alte Muster zurückzufallen und zur Droge zu greifen. In der Forschung werden beide Mechanismen auch an Tiermodellen nachgestellt, etwa um herauszufinden, was bei den jeweiligen Rückfällen im Gehirn passiert. "Diese Modelle sind aus Beobachtungen des menschlichen Rückfalls entstanden“, erklärt Anita Hansson. Deshalb könne man von ihnen gut auf die Mechanismen bei Patienten schließen.
Artikel Abschnitt: Warum ist es so schwer, eine Sucht loszuwerden?
Warum ist es so schwer, eine Sucht loszuwerden?
Der schwerste Schritt sei es, erst einmal zu bemerken, dass man süchtig ist, sagt Mathias Luderer von der Suchtmedizin am Universitätsklinikum der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er rechnet am Beispiel Alkohol vor: Die meisten seiner Patienten kämen mit etwa Mitte 40 in die Suchtklinik. Abhängig seien sie oft aber schon seit etwa 10 Jahren und seit ihrer Jugend trinken sie mehr als andere – macht insgesamt etwa 30 Jahre erhöhten Alkoholkonsum. "Es ist ein schleichender Prozess, den man lange gar nicht mitbekommt“, so Luderer.
Schaffen Betroffene es irgendwann, sich Beratung zu suchen, haben sich die Verhaltensmuster schon tief eingeprägt. Gewohnheiten, die automatisiert ablaufen, lassen sich nur schwer löschen. Mathias Luderer erzählt: „Patienten berichten manchmal, sie wüssten gar nicht, warum sie wieder angefangen haben zu trinken. Sie waren nur einkaufen und haben aus Gewohnheit und ohne nachzudenken an der Kasse einen Flachmann auf das Band gelegt.“ Die Herausforderung liege dann darin, die bewusste Kontrolle wiederzuerlangen.
Wie schnell sich eine Sucht einstellt und wie lange sie unbemerkt bleibt, hängt von den Substanzen ab. Bei Heroin etwa geht es wesentlich schneller als bei Alkohol, dafür sind die Effekte und die Anpassungen im Gehirn auch sofort stärker.
Soziale Stützen
Wer mit Suchtproblemen in Behandlung geht, hat oft schon viel verloren: Beziehungen, den Arbeitsplatz oder gar die Wohnung. Die Reihenfolge kann dabei unterschiedlich sein: Manche nehmen Drogen, um mit den Umständen in ihrem Leben klarzukommen. Andere sorgen durch ihren Drogenkonsum erst für genau diese Umstände. Sicher ist, dass es unter Wohnungslosen deutlich mehr Drogensüchtige gibt als in der gesamten Bevölkerung.
Gerade für Menschen ohne soziales Netzwerk, ohne Familie und ohne Arbeit ist es schwierig, von den Drogen loszukommen. Es fehlen wichtige Stützen, die vor einem Rückfall schützen könnten. Genau deshalb sollte man sich möglichst früh beraten lassen, anstatt zu warten, bis man wohnungslos ist.
Was das für die Behandlung bedeutet, erklärt Dr. Nora Volkow, Direktorin des National Institute on Drug Abuse (NIDA) in den USA: "Es ist nicht realistisch, zu erwarten, dass eine Tablette ausreicht, um eine Sucht zu behandeln. Wir brauchen ein langfristiges Pflegemodell, in dem Betroffene monate- oder sogar jahrelang nach dem letzten Drogenkonsum noch unterstützt werden.“
Stigma und Selbstlügen
Noch immer sind Suchterkrankungen mit einem Stigma behaftet. Das hält manche Menschen mit einem Drogenproblem davon ab, Hilfe zu suchen. Schließlich möchten sie nicht als "Alki“ oder "Junkie“ angesehen werden. Lieber rette man sich in Vergleiche, sagt Mathias Luderer. “Wenn ich viel trinke, sage ich, ich bin nicht abhängig, denn ich habe ja noch meinen Job. Werde ich arbeitslos, habe ich immerhin noch meine Frau oder meine Wohnung.“ Das nennt sich Selbstwertstabilisierung. Man schätzt sich selbst positiver ein als andere – und verpasst so die Signale, die zeigen, dass man Hilfe braucht.
Veränderungen im Gehirn
Ein weiterer Grund, warum Suchtpatientinnen und -patienten häufig rückfällig werden, sind die Veränderungen im Gehirn. Nach einer längeren Abstinenz normalisieren sich einige Prozesse zwar wieder, doch es bleiben Spuren. Etwa dass bestimmte Reize selbst nach einer langen Zeit die Erinnerung an die Droge wecken und dazu verleiten, zu alten Verhaltensmustern zurückzukehren.
Artikel Abschnitt: Warum werden manche Menschen eher süchtig als andere?
Warum werden manche Menschen eher süchtig als andere?
Risikofaktoren machen eine Sucht wahrscheinlicher
Ob jemand tatsächlich eine Sucht entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sehr wichtig ist die genetische Veranlagung: Der Einfluss der Gene liegt bei etwa 40 bis 60 Prozent. Dazu kommen epigenetische Prozesse. Die Epigenetik bestimmt die Faltung der DNA, also etwa ob die einzelnen Stränge fest zusammengewickelt oder eher locker und gut zu erreichen sind. So reguliert sie, welche Gene zu welchem Zeitpunkt und wie häufig abgelesen werden.
Stress oder Traumata in der Kindheit oder Jugend können ebenso zu einer Suchterkrankung beitragen.
Nicht zu unterschätzen sei außerdem der Zugang zu den Substanzen, sagt Nora Volkow. "Alkohol- und Nikotinsucht sind am weitesten verbreitet – nicht weil diese Drogen das größte Suchtpotenzial haben, sondern weil sie legal und in der Gesellschaft akzeptiert sind.“
Stigma: ein großes Problem
All das zeigt außerdem, wie problematisch die Stigmatisierung von Drogensucht als "das haben sie sich selbst ausgesucht, sie könnten ja aufhören oder hätten gar nicht erst anfangen müssen“ ist. Von außen lässt sich kaum beurteilen, was bei einem Patienten alles zusammenspielt. So gibt es Menschen, die schwere Traumata erleben, ohne später süchtig zu werden. Andere Menschen scheinen ein behütetes Leben zu führen und entwickeln trotzdem eine Suchterkrankung. Die Schuld auf die Patientinnen und Patienten zu schieben, ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch schädlich für die Betroffenen.
Artikel Abschnitt: Welche Rolle spielen andere psychische Erkrankungen bei der Drogensucht?
Welche Rolle spielen andere psychische Erkrankungen bei der Drogensucht?
Diese sogenannte Komorbidität kann auf verschiedenen Wegen entstehen:
- Die psychische Erkrankung trägt zum Drogenkonsum und zur Entstehung der Sucht bei. Die Drogen helfen den Betroffenen kurzfristig, sich besser zu fühlen, und so wird es auch immer schwieriger, damit aufzuhören.
- Der Drogenkonsum und die Sucht tragen zur Entwicklung einer psychischen Erkrankung bei.
- Oder: Es gibt gemeinsame Risikofaktoren (wie die Gene, die Erlebnisse, den Stress), die sowohl eine psychische Erkrankung als auch die Sucht begünstigen.
Wer gleichzeitig an einer psychischen Krankheit und einer Suchterkrankung leidet, hat es noch schwerer, die Sucht loszuwerden. Dazu kommt: Bei einer zusätzlichen psychischen Erkrankung fehlt den Betroffenen oft eine gewisse Stabilität in ihrem Tagesablauf und ihrem sozialen Umfeld, die beim Drogenverzicht unterstützen könnte.
Besonders problematisch ist auch, dass Selbstmordgedanken und tatsächlicher Selbstmord bei Menschen mit einer Suchterkrankung häufiger sind als bei anderen. Das wird noch verstärkt durch soziale Isolation – eine Tatsache, die gerade in Zeiten von Covid-19 mitbedacht werden sollte, sagt Nora Volkow. "Wir sollten die Menschen dazu ermuntern, die Pandemie mit gesunden Verhaltensweisen zu überstehen, die sich nicht auf Drogenkonsum stützen, um der Angst oder Einsamkeit zu entkommen.“ Gesunde Möglichkeiten wären etwa Sport oder ein anderes Hobby, in das man sich ganz vertiefen kann. Leider hat sich gezeigt, dass gerade der Alkoholkonsum seit Beginn der Pandemie angestiegen ist.
Weitere Angaben zum Artikel:
Hilfe bei Selbstmordgedanken
Artikel Abschnitt: Was kann gegen die Sucht helfen?
Was kann gegen die Sucht helfen?
Mathias Luderer hat auch einen Tipp für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt ein Problem haben: Einfach mal vier bis sechs Wochen verzichten. "Ist dann das Verlangen nach der Substanz so stark, dass man die Abstinenz nicht durchhält, sollte man professionelle Unterstützung suchen.“ Das gilt besonders bei Menschen, die bei einem Verzicht starke Entzugssymptome entwickeln.
Medikamente – allein oder in Kombination?
Bei der Behandlung kommt es sehr auf die Art der Droge an. Oft ist eine Kombination aus Psychotherapie und Medikamenten am erfolgreichsten. Die vorhandenen Medikamente helfen allerdings nicht allen Betroffenen, deshalb suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter nach Ansatzpunkten für neue Therapien. So könnte man mit Medikamenten andere Komponenten im Suchtzyklus blockieren, die bisher nicht so viel Beachtung gefunden haben.
Möglicherweise hilft auch die Kombination von bestehenden Medikamenten, um die Wirksamkeit zu steigern. Das zeigte ein amerikanisches Team 2021 für Crystal Meth (Methamphetamin): Sie verabreichten Abhängigen gleichzeitig Bupropion, ein Antidepressivum, und Naltrexon, das die Opioidrezeptoren hemmt. Zwar erreichten sie damit keine großen Effekte, aber immerhin größere als in der Kontrollgruppe, die ein Placebo bekam. Allerdings verglichen die Forschenden in dieser Studie nicht die Wirkung von Naltrexon oder Bupropion allein. So ist es schwer, zu sagen, ob eines der Medikamente bereits ausgereicht hätte, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen.
Neue Behandlungsansätze für die Zukunft
Andere Arbeitsgruppen suchen nach neuen Wegen, um die Suchterkrankung zu bekämpfen. Etwa mit psychedelischen Substanzen wie Psilocybin aus Pilzen, die möglicherweise die durcheinandergeratenen Netzwerke im Gehirn sortieren. Der Ansatz ist nicht neu, war aber für längere Zeit in den Hintergrund geraten, weil die Forschung mit solchen Substanzen einige praktische und ethische Herausforderungen stellt.
Das Gehirn zu stimulieren, wäre eine weitere Möglichkeit. Eine amerikanische Forschungsgruppe versucht das mit der transkraniellen Magnetstimulation (TMS), bei der eine Magnetspule auf dem Schädel kurzzeitig ein Magnetfeld erzeugt. Möglich wäre auch eine Tiefe Hirnstimulation (THS), bei der Elektroden in eine bestimmte Gehirnregion eingesetzt werden und dann elektrische Signale abgeben.
Doch eine systematische Zusammenfassung kam kürzlich zu dem Schluss, dass vor allem noch placebokontrollierte und verblindete Studien nötig sind, um zu sehen, ob die THS bei Drogensucht tatsächlich sicher und effektiv ist. Das heißt, die Testpersonen (und bei doppelter Verblindung auch die Behandelnden selbst) wissen nicht, wer ein Placebo bekommt und wer die neue Therapie.
Substitution, ein bewährtes Mittel
Eine effektive Behandlung bei Opioid-Sucht gibt es indessen schon: die Substitutionstherapie. Dabei bekommen die Patientinnen und Patienten unter kontrollierten Bedingungen regelmäßig eine Ersatzdroge verabreicht, beispielsweise Methadon. Das hat verschiedene Vorteile. So sind die klinischen Präparate sauber und die Menge festgelegt. Die Patienten müssen sich zudem keine Gedanken darüber machen, wie sie an ihre Droge kommen – die Beschaffung ist ansonsten ein großer Stressfaktor und führt teilweise zu Prostitution oder kriminellen Aktivitäten. Mit einer Substitutionstherapie ist es möglich, wieder ein geregelteres Leben zu führen. Das ist auch das vorrangige Ziel einer solchen Therapie; es geht nicht unbedingt darum, ganz von der Droge wegzukommen. Problematisch ist, dass zu wenige Ärzte eine Substitutionstherapie anbieten.
Artikel Abschnitt: Muss man für immer aufhören, um eine Sucht zu überwinden?
Muss man für immer aufhören, um eine Sucht zu überwinden?
Über den Autor:
Quellenangaben zum Artikel:
Social Sharing:
Artikel Überschrift:

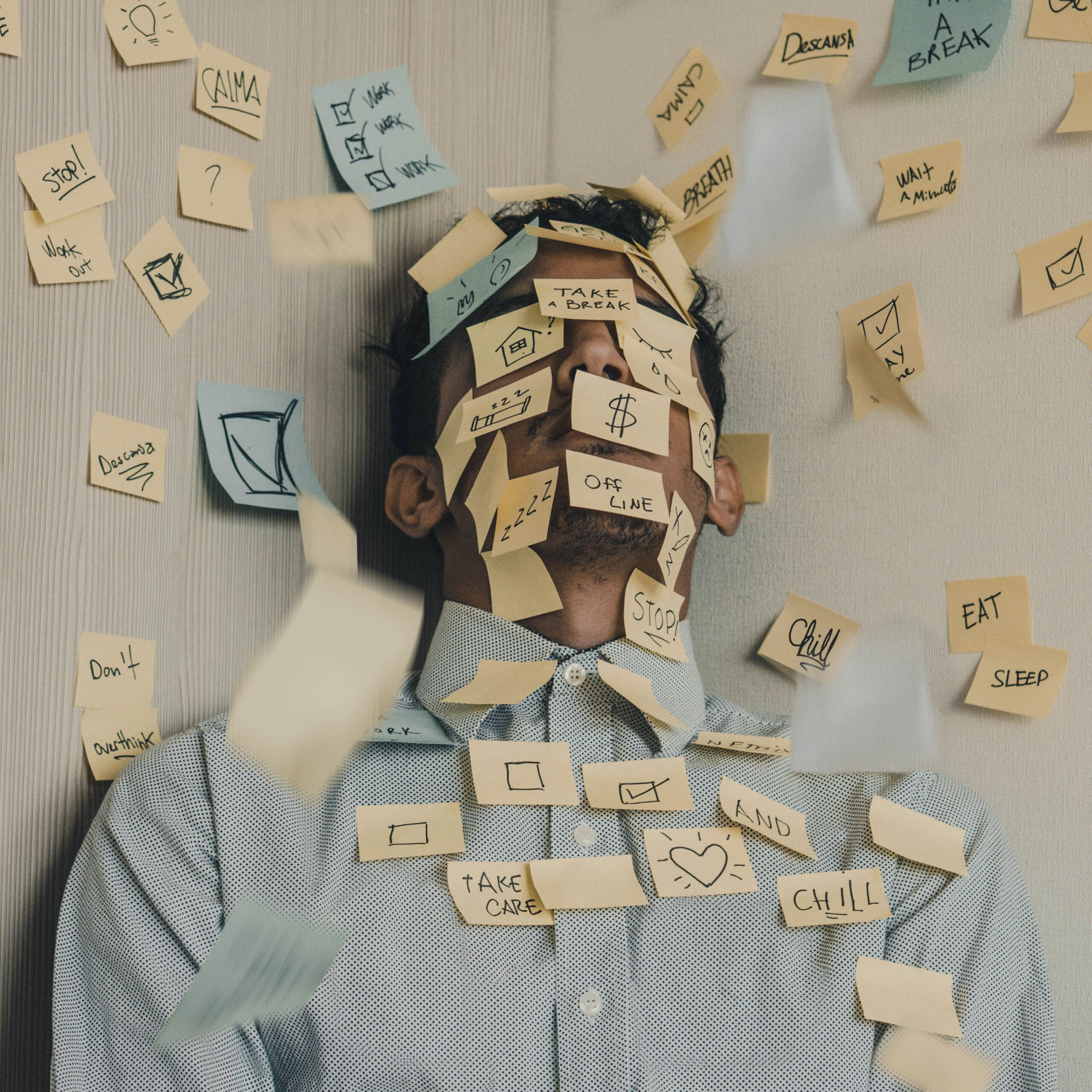




🦍💨
Sehr guter Artikel. Es hat mir sehr geholfen die Sucht zu erkennen, behandeln und sie zu verstehen. Das macht es mir sehr viel einfacher geheilt zu werden. Es gibt aber auch Natürliche heilmethoden Methoden wie zb Ayuaska, oder andere pflanzliche mittel die dabei helfen die sucht besiegen. Ich werde mich… Weiterlesen »
Ein guter Artikel, aber zu VERFANGEN IN DER THEORIE. In der praktischen Arbeit in der Sucht- und Suizidprävention, wobei der SELBSTERLEBTE WEG IN DIE, UND AUS DER SUCHT, mit wenig Theorie, sehr erfolgreich ist (eine Grundlager der AA). Natürlich kann man nach einer Zeit über Ursachen forschen, sie dürfen nicht… Weiterlesen »
Ein sehr guter Artikel, vielen Dank dafür. Was allerdings nahezu komplett fehlt, ist die Darstellung und die Erfolgsaussichten verschiedenster psychotherapeutischer Behandlungsansätze. Denn die Suchtbehandlung fußt zu einem großen Teil auf Psychotherapie, und eben nicht z.B. auf „Pillen“, TMS oder TCS.
Danke fuer die ausfuerliche Darstellung. Mein Hauptproblem sind die Wissenschaftliche Methoden selber, nicht ein bestimmtes Problemgebied. Wenn ein Zimmermann nur einen Hammer als Werkzeug hat, dann sind alle seine Arbeiten davon gepraegt. Ihre Wissenschaft nutzt fast nur die statistische Methode, ein Werkzeug das geeiged ist fuer Problemen mit einen sehr… Weiterlesen »